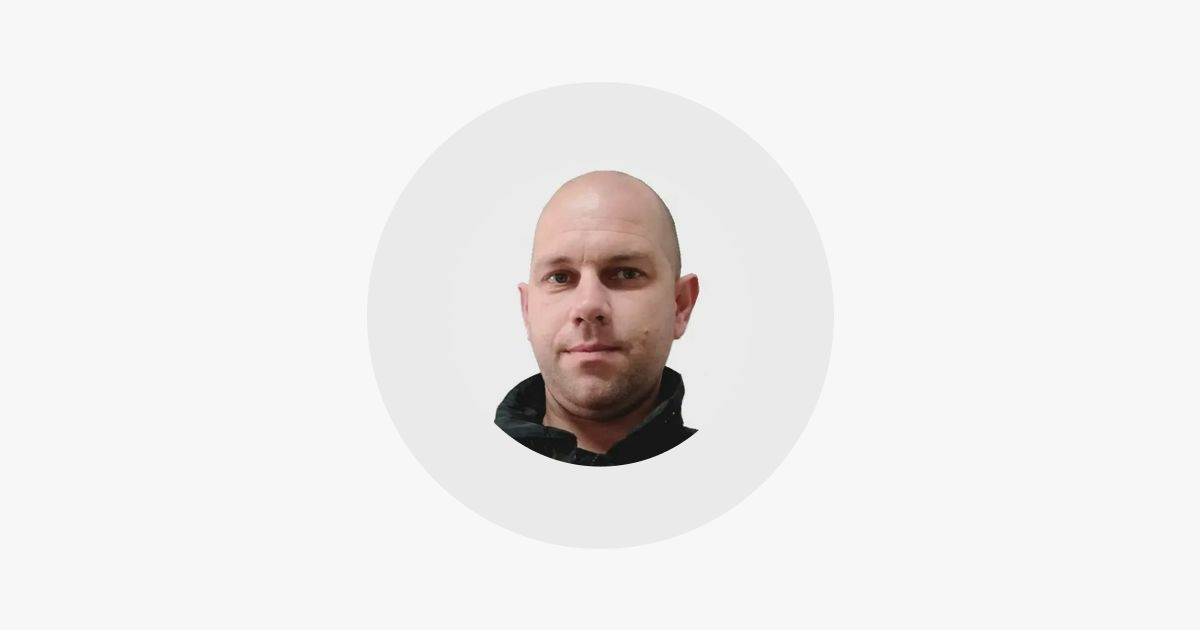Das ungarische Dorf, in dem Dutzende Frauen ihre Ehemänner töteten

Am 14. Dezember 1929 berichtete die amerikanische Zeitung „New York Times“ über eine Nachricht, die nicht nur in den USA, sondern auch in Ungarn für Erstaunen sorgte: Es war der Beginn eines Prozesses gegen etwa 50 Frauen, denen vorgeworfen wurde, die große Mehrheit der Männer vergiftet zu haben, die in einem abgelegenen Dorf des europäischen Landes lebten.
Obwohl die Notiz kurz war, war der Bericht voller Details: Zwischen 1911 und 1929 hatten mehrere Frauen aus der Stadt Nagyrev, etwa 130 Kilometer südlich von Budapest, mehr als 50 Männer vergiftet.
Die Frauen wurden „Engelmacherinnen“ genannt und sollen die Männer mit einer Arsenlösung ermordet haben.
Manche bezeichnen den Vorfall als den größten Massenmord an Männern durch Frauen in der modernen Geschichte.
Den Frauen wurde ein öffentlicher Prozess gemacht, bei dem immer wieder ein Name fiel: Zsuzsanna Fazekas, die Hebamme des Dorfes.
Damals, als das Dorf noch unter der Herrschaft der österreichisch-ungarischen Monarchie stand und es noch keine Ärzte im Ort gab, hatte die Hebamme das Monopol auf die medizinische Versorgung im Dorf.
In einer BBC-Radiodokumentation aus dem Jahr 2004 berichtete eine Dorfbewohnerin, dass Fazekas als Anstifterin der Vergiftungen identifiziert wurde, weil alle Frauen ihr ihre Probleme erzählt hatten.
„Sie sagte den Frauen, dass sie eine einfache Lösung hätte, wenn sie Probleme mit ihren Männern hätten“, erklärte Maria Gunya.
Und obwohl Fazekas die Hauptverantwortung für die Morde trug, offenbaren die Aussagen der Dorffrauen in den Gerichtsakten tiefe und schmerzhafte Geschichten über Missbrauch, Misshandlung und Vergewaltigung durch die Männer.
Doch die Geschichte blieb viele Jahre lang im Verborgenen. Polizeiberichten zufolge wurden die ersten Morde bereits 1911 registriert, die Ermittlungen begannen jedoch erst 1929.
Welche Spur führte zu den Tätern?
Ein Friedhof, der plötzlich voll wurde.

Im Jahr 1911 kam Zsuzsanna Fazekas im Dorf Nagyrev an.
Laut Gunya und den Zeugen im Prozess fiel sie aus zwei Gründen auf: Erstens, weil sie sich neben ihren Fähigkeiten als Hebamme auch mit medizinischen Heilmitteln auskannte, bei manchen sogar mit chemischen Mitteln, was in der Region ungewöhnlich war.
Zweitens fehlte von ihrem Mann jede Spur.
„Nagyrev hatte keinen Priester, geschweige denn einen Arzt. Ihr Wissen sorgte dafür, dass die Leute auf sie zukamen und ihr vertrauten“, erzählte Gunya.
„Frauen sahen, wie in ihren Häusern viele Dinge passierten: Männer, die Frauen schlugen, die sie vergewaltigten, viele von ihnen waren untreu. Es gab viel Misshandlung“, fügte sie hinzu.
Fazekas begann daraufhin, eine damals verbotene Praxis durchzuführen: klinische Abtreibungen ungewollter Schwangerschaften. Aus diesem Grund wurde sie vor Gericht gestellt, jedoch nie verurteilt.
Das große Problem bestehe darin, dass viele Ehen von den Familien arrangiert würden und sehr junge Frauen teilweise viel ältere Männer heirateten.
„Damals gab es noch keine Scheidung. Man konnte sich nicht trennen, selbst wenn man misshandelt oder missbraucht wurde“, sagte sie.
Doch Berichte aus dieser Zeit wiesen auch auf eine andere Tatsache hin: Arrangierte Ehen waren mit einer Art vertraglicher Vereinbarung verbunden, die Land, Erbschaften und rechtliche Verpflichtungen umfasste.
„Fazekas begann, Frauen davon zu überzeugen, dass sie ihre Probleme lösen könne“, erklärte Gunya der BBC.
Die erste Vergiftung ereignete sich im Jahr 1911. In den darauffolgenden Jahren starben immer mehr Männer, während der Erste Weltkrieg wütete und die österreichisch-ungarische Monarchie zerfiel.

In 18 Jahren starben zwischen 45 und 50 Ehemänner und Väter, die auf dem Dorffriedhof begraben wurden.
Viele begannen, Nagyrev als „Bezirk der Mörder“ zu bezeichnen.
Diese Einzelheiten erregten die Aufmerksamkeit der Polizei. Anfang 1929 begann man mit der Exhumierung der Leichen zur Untersuchung und fand dabei ein belastendes Element: Arsen.
Der ProzessFazekas lebte in einem typischen einstöckigen Haus im Dorf mit Blick auf die Straße. Dort stellte sie viele der Gifte her, die bei den Morden verwendet wurden.
Dort sah sie am 19. Juli 1929, dass die Polizei kam, um sie abzuholen.
„Als sie die Gendarmen näher kommen sah, verstand sie, dass es für sie vorbei war. Als sie das Haus erreichten, war sie bereits tot; sie hatte etwas von ihrem eigenen Gift genommen.“
Doch die Hebamme war bei weitem nicht die einzige Schuldige.
In der nahegelegenen Kreishauptstadt Szolnok wurden ab 1929 26 Frauen vor Gericht gestellt.
Acht wurden zum Tode verurteilt, die übrigen ins Gefängnis geschickt, sieben davon zu lebenslanger Haft.
Nur wenige gaben ihre Schuld zu und ihre Motive waren nie ganz klar.
Der Arzt und Historiker Geza Cseh erklärte der BBC anhand von Gerichtsakten, dass es noch viele ungelöste Rätsel gebe.
„Zu den Gründen gibt es viele Theorien: Armut, Gier und Langeweile sind einige davon“, betont der Wissenschaftler.
„Einige Berichte besagen, dass einige Frauen Liebhaber unter den russischen Kriegsgefangenen hatten, die in Abwesenheit ihrer Männer an der Front zur Arbeit auf Bauernhöfen eingezogen wurden“, erklärte der Historiker.
Und als die Ehemänner zurückkehrten, beklagten die Frauen den plötzlichen Verlust ihrer Freiheit und beschlossen, eine nach der anderen, zu handeln.

In den 1950er Jahren traf der Historiker Ferenc Gyorgyev während seiner Gefangenschaft unter dem kommunistischen Regime einen älteren Dorfbewohner.
Der Bauer behauptete, dass die Frauen von Nagyrev „seit undenklichen Zeiten ihre Männer ermordet hätten“.
Außerdem waren sie möglicherweise nicht die einzigen.
In der nahegelegenen Stadt Tiszakurt enthielten auch andere exhumierte Leichen Arsen, doch für diese Todesfälle wurde niemand verurteilt.
Schätzungen zufolge könnte die Gesamtzahl der Todesopfer in der Region 300 betragen haben.
Gunya weist darauf hin, dass sich das Verhalten der Männer gegenüber ihren Frauen nach den Vergiftungen „merklich verbessert“ habe.
 BBC News Brasil – Alle Rechte vorbehalten. Jegliche Vervielfältigung ohne schriftliche Genehmigung von BBC News Brasil ist untersagt.
BBC News Brasil – Alle Rechte vorbehalten. Jegliche Vervielfältigung ohne schriftliche Genehmigung von BBC News Brasil ist untersagt.
terra