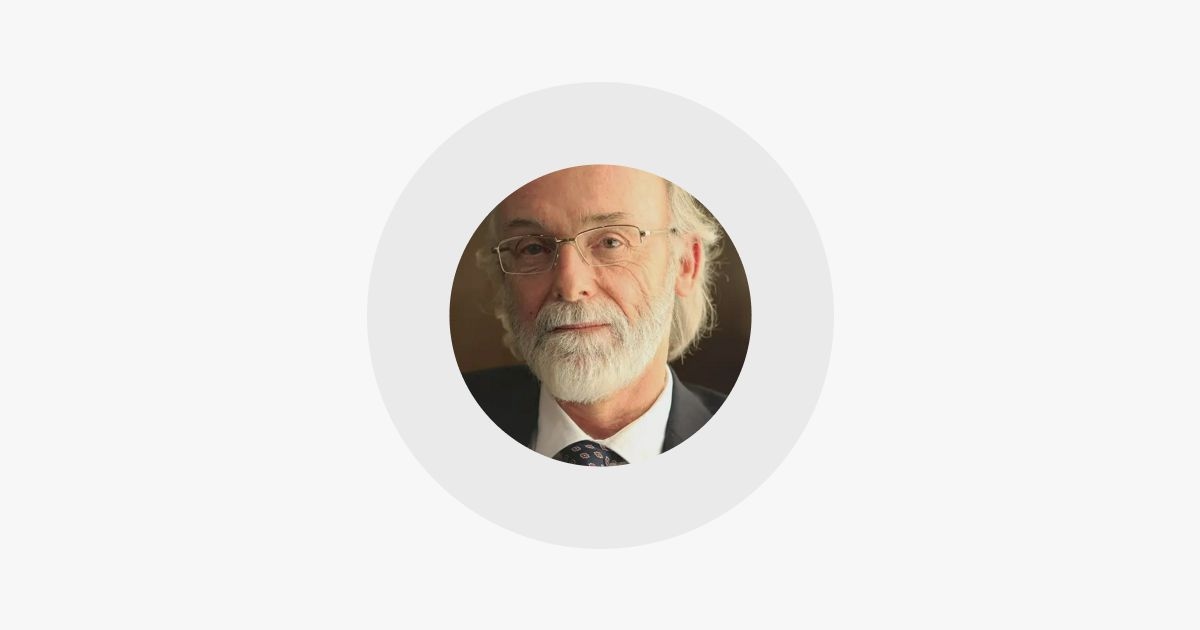Zu viele Häuser? Das Land braucht jemanden, der sie in Ruhe vermieten kann.

Laut Jornal de Notícias gibt es im Land tatsächlich Hunderttausende bezugsfertige Wohnungen. Sie sind in Volkszählungen, Satellitenbildern und Statistiken verzeichnet. Offenbar fehlt nur noch jemand, der sie öffnet. So provokant der Artikel auch klingt, der Subtext ist ernster: Wenn die Wohnungen existieren und ungenutzt bleiben, ist das Problem nicht struktureller, sondern moralischer Natur. Die Schuld liegt bei den Eigentümern, nicht bei denen, die regieren oder regiert haben. Wie immer ist der Feind der Eigentümer.
Dieser Diskurs, der Ressentiments mit Naivität vermischt, gewinnt in ganz Europa an Boden. Politiker aus dem gesamten politischen Spektrum wiederholen Variationen desselben Themas: Der Markt habe versagt, der Staat müsse eingreifen, das Recht auf Wohnen habe Vorrang vor Privateigentum. Es ist Wohnungspopulismus, getarnt als soziale Gerechtigkeit. Und wie jeder Populismus bietet er Schuldzuweisungen statt Lösungen.
Das Problem ist, dass sich die Realität nicht leeren Slogans beugt. Ja, die Häuser existieren. Aber sie sind geschlossen, weil ihre Eigentümer vom System ungeschützt gelassen wurden. Und dieser Mangel an Schutz ist weder die Paranoia der Reichen noch eine Verschwörung von Immobilienfonds. Es ist eine rationale Reaktion auf einen strafenden regulatorischen und fiskalischen Kontext, der über Jahrzehnte geformt wurde. Regierungen, die Regulierung mit Tugend verwechseln und glauben, die Preisfestsetzung per Dekret reiche aus, um das Gesetz von Angebot und Nachfrage außer Kraft zu setzen.
Immobilienbesitz ist in Portugal heute riskant. Der Staat behandelt Eigentum als fragwürdiges Privileg, nicht als garantiertes Recht. Das Justizsystem ist langsam. Die Besteuerung ist unbeständig, belastend und strafend. Die Gesetzgebung ändert sich je nach politischem Wind, was zu Unsicherheit bei Verträgen und Fragilität im Verhältnis zwischen Vermietern und Mietern führt. Und als ob das alles nicht schon schlimm genug wäre, wird ein öffentlicher Diskurs angeheizt, der Hausbesetzungen romantisiert und diejenigen, die investieren, verteufelt.
Dies ist das Szenario, das Tausende von Immobilien vom Markt nimmt. Nicht aus Habgier, sondern aus Rechtsunsicherheit. Kleineigentümer, die eine Wohnung geerbt, ihre Ersparnisse in ein Mietobjekt investiert und geplant haben, ihren Ruhestand mit einer monatlichen Miete aufzubessern, haben den Markt verlassen. Nicht, weil sie schlechte Bürger sind, sondern weil sie nicht zu Opfern des Rechts werden wollen. Dieses Verhalten ist nicht irrational. Es ist die logische Reaktion auf ein feindliches Umfeld. Und genau hier bietet die Wirtschaftstheorie den Schlüssel zum Verständnis der Geschehnisse. George Stigler, Nobelpreisträger für Wirtschaftswissenschaften, erklärte 1971, dass Regulierung nicht neutral sei . Sie werde oft von Interessengruppen vereinnahmt und zum Schutz etablierter Unternehmen eingesetzt, wodurch Markteintrittsbarrieren geschaffen und der Markt verzerrt werde. Anne Krueger hat nachgewiesen, dass diese Regulierung künstliche Renten erzeugt, die das Rent-Seeking fördern – das Streben nach Profit durch politischen Einfluss statt durch Innovation oder Effizienz.
Gordon Tullock zeigte, dass dieses Verhalten hohe soziale Kosten verursacht. Ressourcen, die für die Sanierung von Gebäuden oder die Entwicklung von Mobilitätslösungen eingesetzt werden könnten, werden für Klagen , politische Lobbyarbeit und andere Fehltritte verschwendet. Sam Peltzman und Mancur Olson vervollständigten das Bild: Mit der Zeit akkumulieren sich diese Verzerrungen , verringern die Produktivität, behindern das Wachstum und vertiefen die Ungleichheiten. Was in der Praxis funktioniert, hat sich endlich einmal bewährt.
Der portugiesische Immobilienmarkt ist ein Paradebeispiel. Wir haben kontrollierte Mieten, langsame Zwangsräumungen, perverse Anreize und ein Rechtssystem, das säumige Zahler schützt. Wir haben einen Staat, der jedem das perfekte Zuhause verspricht und gleichzeitig diejenigen bestraft, die es wagen, echte Wohnungen mit echten Kosten, echten Risiken und echten Verträgen anzubieten.
Die Folge ist tragisch: weniger Angebot. Und mit weniger Angebot mehr Wettbewerb um die wenigen verfügbaren Immobilien. Und mit mehr Wettbewerb höhere Preise. Ironie der Ironie: Preiskontrollen, gesetzliche Beschränkungen und moralistische Rhetorik lösen das Problem nicht nur nicht, sie verschärfen es sogar. Sie wollen Mieter schützen und drängen sie letztlich in die Prekarität. Sie wollen Bezahlbarkeit garantieren und reduzieren letztlich die Auswahl. Sie wollen Gerechtigkeit durchsetzen und schaffen letztlich Knappheit.
Was sollten wir angesichts dessen tun? Freiheit. Aber keine abstrakte oder ideologische Freiheit. Eine konkrete Freiheit, die auf vertraglicher Verantwortung, Rechtssicherheit und Respekt vor Eigentum beruht. Das bedeutet, Vermietern und Mietern freie Verhandlungen zu ermöglichen. Das bedeutet, die Einhaltung von Verträgen sicherzustellen. Das bedeutet, das Justizsystem zu straffen, außergerichtliche Streitbeilegungsmechanismen zu schaffen, den Steuerrahmen zu stabilisieren und Wohnraum als Wirtschaftsgut und nicht als politische Waffe zu betrachten.
Diese Freiheit ist der einzige ernsthafte Weg, das Angebot zu erhöhen. Denn ohne Vertrauen gibt es keine Investitionen. Ohne Vorhersehbarkeit keine Sanierung. Und ohne Respekt für die Rechte derer, die eine Wohnung haben, wird es nie Wohnraum für diejenigen geben, die keine haben.
Und nein, das ist keine liberale Utopie. Es funktioniert bereits in Dutzenden von Ländern. Man schaue sich nur die europäischen Beispiele an, die Eigentumsrechte respektieren, freie Mietverträge zulassen und über lebendige und bezahlbare Mietmärkte verfügen. Als man in Berlin versuchte, die Mieten per Gesetz einzufrieren, sank das Angebot, die Preise auf dem freien Markt schossen in die Höhe und die Maßnahme musste zurückgenommen werden . In Stockholm führten jahrelange staatliche Mietpreiskontrollen zu einem Schwarzmarkt für Untervermietung, auf dem nur diejenigen eine Wohnung bekommen, die „Freunde“ haben . In Barcelona träumte man zwar von einer katalanischen Kommune, kehrte dem Markt aber den Rücken. Städtische Eingriffe schreckten Investoren ab, stoppten den Bau von Wohnungen und drängten den Wohnungsmarkt in die Informalität.
Portugal scheint entschlossen, all diese Fehler zu wiederholen. Und es tut dies mit geradezu religiöser Überzeugung. Jedes neue Gesetz, das die Vertragsfreiheit einschränkt, wird als zivilisatorischer Fortschritt verkauft. Jede Maßnahme, die den Großgrundbesitz schwächt, wird bejubelt, als handle es sich um soziale Gerechtigkeit. Jeder Angriff auf das Eigentum wird als Verteidigung der Schwachen verklärt. Doch all das hat seinen Preis. Und ironischerweise tragen genau die Menschen diesen Preis, die es eigentlich schützen sollte.
Wollen wir die Wohnungskrise lösen? Beginnen wir mit der Öffnung des Marktes. Hören wir auf, den Wohnungsmarkt als ideologischen Graben zu betrachten, und beginnen wir, ihn als das zu betrachten, was er ist: ein wichtiger Markt, der Angebot, Investorenschutz und Rechtssicherheit benötigt.
Und hören wir bitte auf, immer wieder zu behaupten, es gäbe Tausende bezugsfertige Wohnungen. Sie stehen aufgrund von Gesetzen, Ineffizienz und Unsicherheit nicht zur Verfügung. Solange sich das nicht ändert, dient die Schuldzuweisung an die Eigentümer nur der Rhetorik derjenigen, die Privateigentum angreifen. Das wahre Problem liegt jedoch bei denen, die Mieter blockieren, entmutigen und schikanieren.
observador