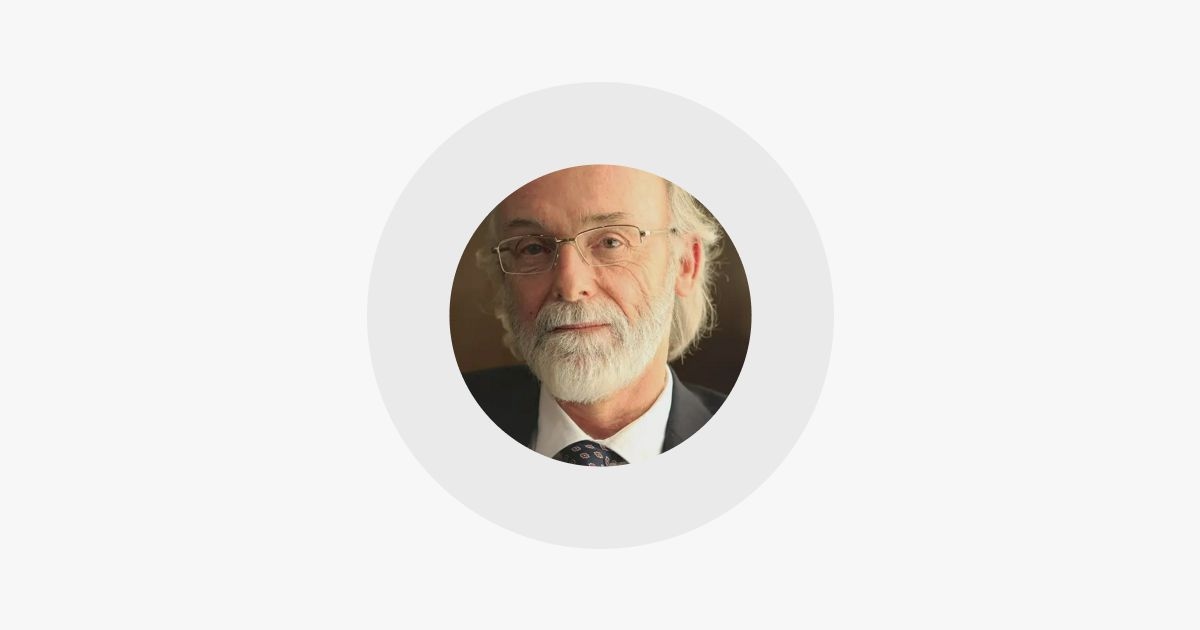Justiz und Technologie: eine unvermeidliche transformative Beziehung

Wir leben in einer Zeit tiefgreifender Transformationen in allen Bereichen, und Technologie ist ein zentraler Treiber dieser Veränderungen. Historisch gesehen hat Technologie die Gesellschaft stets neu geprägt, und heute erleben wir eine Revolution, die auch in den Rechtssystemen stattfindet und durch die Digitalisierung und insbesondere durch generative künstliche Intelligenz (KI) vorangetrieben wird. Obwohl noch viel vom „digitalen Wandel“ gesprochen wird, erfordert die Realität, dass wir uns auf den „technologischen Wandel“ konzentrieren. Dieses transformative Bewusstsein ist unerlässlich, um die kritischen und komplexen Herausforderungen der Gegenwart zu bewältigen. Diese Realität setzt öffentliche Institutionen, einschließlich des Justizsystems, unter Druck, effizienter, widerstandsfähiger und anpassungsfähiger zu werden. Der Einsatz digitaler Lösungen und künstlicher Intelligenz (KI) ist daher keine Annehmlichkeit, sondern ein Muss.
Technologie geht über die bloße Funktion eines Werkzeugs hinaus; sie ist tief in das Recht integriert und beeinflusst die organisatorischen, verfahrenstechnischen und institutionellen Dimensionen menschlicher Interaktionen. Diese Perspektive definiert die Konzeption, Produktion und Anwendung von Recht neu und erfordert einen Übergang von einer rein menschenzentrierten Epistemologie zu einer, die die Fähigkeit von Maschinen berücksichtigt, Wissen zu schaffen und menschliche Entscheidungen bei der Umsetzung von Recht und Rechtsprechung zu unterstützen oder sogar zu ersetzen.
Technologische Instrumente im Rechts- und Justizbereich halten mit der Entwicklung von Informationssystemen und KI Schritt. Zu den wichtigsten digitalen und KI-Systemen in Gerichten gehören:
- IAG: Generiert neue Inhalte (Bilder, Videos, Texte) aus vorhandenen Daten, wie z. B. Chatbots und virtuelle Assistenten. Im juristischen Kontext kann IAG Rechtstexte und Dokumente erstellen.
- OCR (Optische Zeichenerkennung): Konvertiert Bilder mit Text in lesbare und bearbeitbare Formate und ermöglicht so die Suche und Bearbeitung in gescannten Dokumenten oder PDFs.
- RPA (Robotic Process Automation): Automatisiert regelbasierte Prozesse mithilfe virtueller Roboter für manuelle und sich wiederholende Aufgaben.
- API (Application Programming Interface): Regelsatz, der die Kommunikation zwischen verschiedenen Softwareanwendungen ermöglicht.
- Maschinelles Lernen: Ein Teilbereich der KI, der aus Daten lernt, um die Leistung im Laufe der Zeit ohne menschliches Eingreifen zu verbessern. Es wird in der prädiktiven Analytik verwendet.
- E-Discovery: Verfahren zur Recherche und Beschaffung elektronischer Daten und Informationen in Gerichtsverfahren, mit Tools, die diese Suche automatisieren.
KI-Systeme lassen sich nach Technologie, Struktur, Komplexität, Datenqualität und Funktionalitäten klassifizieren. KI hat sich von einfacheren Systemen zu zunehmend autonomen und komplexen Systemen entwickelt, die in KI-Agenten und Multi-Agenten-Systemen gipfeln. Im Rechtsbereich sind die besten Beispiele deduktive Klassifikatoren für die Datenorganisation, neuronale Netze für prädiktive Analysen und Entscheidungsfindung sowie Deep Learning für das Lernen aus großen Datenmengen. Große Sprachmodelle (LLMs) verstehen und generieren menschenähnliche Texte, während kleine Sprachmodelle (SLMs) spezialisierter sowie ressourcen- und kontexteffizienter sind. Weitere Funktionalitäten umfassen Natural Language Processing (NLP) zum Verständnis menschlicher Sprache und Expertensysteme zur Problemlösung. KI-Assistenten und -Agenten unterstützen bei komplexen Aufgaben, und Retrieval-Augmented Generation (RAG)-Systeme kombinieren Informationsabruf mit generativen Fähigkeiten.
Für die verantwortungsvolle Entwicklung autonomer Systeme ist es entscheidend, zwischen KI-Agenten und Agentur-KI zu unterscheiden. KI-Agenten sind Single-Task-Tools mit geringer Autonomie und einem vorhersehbaren Risikoprofil (z. B. Chatbots). Im Gegensatz dazu verfolgt Agentur-KI, basierend auf Multi-Agentur-Einsatz, Ziele, arbeitet zusammen, passt sich an und agiert zunehmend unabhängig in komplexen Bereichen. Aufgrund ihres offenen Verhaltens birgt sie höhere Risiken und erfordert neue Kontrollmechanismen.
Im Justizwesen muss zwischen KI-Tools unterschieden werden, die im Gerichtsmanagement und in der Justizverwaltung zum Einsatz kommen, und solchen, die Gerichtsentscheidungen unterstützen oder ausarbeiten.
Die Entwicklung der Technologie im Recht gibt Anlass zu Bedenken, die sich in drei miteinander verbundene Bereiche gliedern: Cybersicherheit konzentriert sich auf den Schutz des technologischen Systems vor böswilligen Eingriffen; Cyberdemokratie zielt auf die Verteidigung der Grundrechte der Nutzer (wie etwa des Schutzes personenbezogener Daten) und der Autonomie der Behörden gegenüber dem technologischen System; Cybergovernance schließlich bezeichnet die Regulierung des technologischen Systems selbst, um die Integrität öffentlicher Institutionen und die Qualität der von ihnen ausgeübten Funktionen zu gewährleisten.
Es gibt eine zunehmende Diskussion über die ethischen und sozialen Aspekte der KI, wobei der Schwerpunkt auf Politik und Datenwissenschaft liegt. Bedenken betreffen Datenschutzverletzungen, Fehlinformationen, Voreingenommenheit und Diskriminierung, „Halluzinationen“ (KI-Fehler), Umweltkosten und die Entstehung epistemischer Blasen. Der technologischen Entwicklung und der Neuerfindung der Wirtschaft durch Daten liegt zudem ein wirtschaftliches Problem zugrunde.
Datenaufbereitung und -qualität sind entscheidend für die Digitalisierung und Automatisierung der Justiz. Inventarisierung, Analyse der Datenqualität (ROT) sowie Bewertung von Datenstruktur und -verwaltung sind unerlässlich. Zugriffsmanagement, Auditing, Sicherheit und Workflow-Mapping zur Identifizierung von Automatisierungspotenzialen sind entscheidend. Zusammenarbeit im Datenmanagement und bei Post-Discovery-Maßnahmen sind für eine verantwortungsvolle und effiziente Digitalisierung im Rechtsbereich unerlässlich.
Europa hat sich proaktiv für die Entwicklung rechtlicher und ethischer Rahmenbedingungen für KI in der Justiz eingesetzt, beispielsweise mit der Ethik-Charta des Europarats für den Einsatz von KI in Justizsystemen (2018) und der Verordnung (EU) 2024/1689, die harmonisierte Regeln für künstliche Intelligenz in der Europäischen Union festlegt. Der Europarat hat über die Kommission für die Wirksamkeit der Justiz (CEPEJ) maßgeblich zur ethischen und technischen Integration digitaler Technologien und KI in die europäischen Justizsysteme beigetragen.
Automatisierung und KI erfordern verstärkte regulatorische, organisatorische und Managementanstrengungen der Governance-Strukturen, um robuste Mechanismen zur Bewertung und Zertifizierung technologischer Lösungen zu etablieren. Die Einführung dieser Instrumente impliziert die Übertragung normativer Regelungen auf Maschinen und Computercodes. Die Bewertung technologischer Systeme muss multidisziplinär und interinstitutionell erfolgen und die Vereinbarkeit mit anspruchsvollen Kriterien für das Justizsystem berücksichtigen. Dieser Bewertungsmechanismus muss die Auswirkungen von KI-Systemen auf Grundrechte (Zugang zur Justiz, personenbezogene Daten), die Grundsätze des Gerichtsverfahrens, die Garantien der Rechtsstaatlichkeit (Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der Richter) und die Entscheidungsgründe analysieren. Die Berücksichtigung des Rechts auf ein Gericht und ein faires und gerechtes Verfahren sowie die Vereinbarkeit des Systems mit dem Recht auf Privatsphäre und Datenschutz sind entscheidende normative Standards.
AnsatzebenenDer technologische Wandel hat Auswirkungen auf mehrere Bereiche der Justiz, insbesondere auf Governance, Gerichtsverwaltung und -management, Verfahrensmanagement (im technologischen Prozess) und gerichtliche Entscheidungsfindung.
Der Kontext von Digitalisierung und KI beeinflusst die institutionelle Dynamik und die Umsetzung rechtsstaatlicher Prinzipien, insbesondere der richterlichen Unabhängigkeit. Richterliche Unabhängigkeit muss im Lichte von Transparenz und Rechenschaftspflicht sowie im Einklang mit den neuen systemischen Anforderungen der Technologie konzipiert werden. Digitale Plattformen sind zur standardmäßigen technologischen Unterstützung aller Gerichtstätigkeiten geworden und ermöglichen Automatisierung und intelligente Anwendungen. Es ist entscheidend, dass die Justizverwaltungsorgane die Zertifizierung und Einführung von Werkzeugen, insbesondere von KI, koordinieren. Die zentrale Debatte erstreckt sich nun auch auf den Einsatz digitaler und automatisierter Werkzeuge in Entscheidungsfindungsaufgaben selbst, einschließlich der möglichen automatischen Generierung von Gerichtsentscheidungen.
Die Ebene der Gerichtsverwaltung und der technologischen Prozesse ist entscheidend und verbindet die allgemeine Governance mit dem täglichen Gerichtsmanagement. Das Fallmanagement ist mit dem Einsatz von Technologien zur Fallbearbeitung, Digitalisierung und Informationszirkulation verbunden. Neue Alternativen umfassen Online-Fallbearbeitung, elektronische Verwaltung, Videokonferenzen und die Dematerialisierung von Justizdienstleistungen durch ODR-Plattformen (Online Dispute Resolution). Diese Innovationen rufen jedoch Einwände hervor, wie beispielsweise das mögliche Verschwinden des physischen Gerichtsraums, die Entmenschlichung der Justiz, den Verlust der synchronen Prozessführung, die Abhängigkeit von technologischem Zugang und digitaler Kompetenz sowie die mögliche Unvereinbarkeit mit der richterlichen Unabhängigkeit und den Verlust menschlicher Eingriffe in den Prozess.
Die Ebene der richterlichen Entscheidungsfindung reagiert am empfindlichsten auf die Integration neuer technologischer Instrumente, insbesondere der KI. Der Übergang von der KI als Justizassistent zum effektiven Ersatz des menschlichen Richters (durch eine Behörde) wirft erhebliche ethische, philosophische, politische und verfassungsrechtliche Bedenken auf. Die Risiken der KI-Entwicklung in der richterlichen Entscheidungsfindung werden hervorgehoben, wie etwa Intransparenz (Unverständlichkeit der Systeme), „Datafizierung“ (Minimierung des Kontexts, Voreingenommenheit, Verzerrung moralischer Urteile) und der Verlust der Rechenschaftspflicht sowohl der Institution als auch des Menschen. Es besteht die Gefahr, dass richterliche Entscheidungsträger in die Hände der Entwickler und Betreiber von Datenverarbeitungssystemen gelegt werden, die der prädiktiven Kodierung innewohnen, insbesondere wenn diese als bevorzugter Standard angenommen wird. Auch wenn der Grad der Automatisierung variieren kann, bleibt die grundlegende Integrität des menschlichen Urteils von größter Bedeutung.
An dieser Stelle ist die Frage, ob KI Rechtsauslegung leisten kann, besonders relevant. Rechtsauslegung ist ein hermeneutischer Prozess, eingebettet in soziale Kontexte, ethische Werte und die Dynamik einer menschlichen Rechtsgemeinschaft, der den Dialog zwischen Richtern, Anwälten und Wissenschaftlern beinhaltet. Diese Eigenschaften wecken aufgrund ihrer stark kontextuellen und menschlich-intentionalen Natur ernsthafte Zweifel an der Fähigkeit der KI, Rechtsauslegung vollständig und angemessen zu reproduzieren. Menschliche Auslegung ist nicht bloß eine technische und logische Ableitung von Regeln, sondern ein Prozess, der ethische Intuition sowie menschliche und institutionelle Intentionalität beinhaltet. Dies stellt eine inhärente und möglicherweise unüberwindbare Grenze für die Rolle der KI in grundlegenden juristischen Funktionen dar.
An dieser Stelle sticht die Diskussion um kritische Systeme hervor, die in Gerichten eingeführt werden sollten, sowie die Einführung sogenannter LLM-basierter Human-Agent-Systeme (LLM-HAS). Diese Typologie basiert auf dem Konzept der Zusammenarbeit zwischen Mensch und KI und zielt darauf ab, die Einschränkungen autonomer KI-Modelle zu überwinden. LLM-HAS betonen die wesentliche Rolle menschlicher Interaktion bei der Verbesserung der Zuverlässigkeit, Sicherheit und Leistung von KI. Menschliche Zusammenarbeit kann zu präziseren Entscheidungen, der Einhaltung ethischer Standards und der Wahrung der Rechenschaftspflicht führen, insbesondere in kritischen Sektoren.
Der technologische Wandel im Justizsektor führt zu Spannungen, die ein neues Gleichgewicht zwischen technologischen Ressourcen und den Grundwerten des Justizsystems erfordern. Der Trend zu digitaler Effizienz ist zwar notwendig, kann aber wesentliche Rechtsgrundsätze gefährden, wenn er nicht sorgfältig gesteuert wird. Bei der Governance von Rechtstechnologie geht es nicht nur um die Einführung von Technologien, sondern auch darum, wie dies gelingt, ohne die Grundpfeiler der Justiz zu untergraben.
Es ist unerlässlich, die Integrität der Gerichtsbarkeit zu bewahren und zu stärken und ihre Struktur, einschließlich ihrer technologischen Aspekte, besser zu verstehen. Das Wesentliche muss transformiert und das Wesentliche bewahrt werden. Die Widerstandsfähigkeit unserer wichtigsten Werte kann nur durch die Stärkung ihrer Governance-, Organisations- und Verfahrensaspekte erreicht werden. Werden diese Pläne nicht gestärkt und transformiert, werden Menschlichkeit, Gerechtigkeit und Demokratie die kommenden turbulenten Zeiten nicht überstehen.
Die transformative Beziehung zwischen Justiz und Technologie ist daher unvermeidlich und erfordert einen sorgfältigen und kontinuierlichen Ansatz, um sicherzustellen, dass der technologische Fortschritt den tiefsten Prinzipien der Rechtspflege dient und nicht umgekehrt.
observador