Die Wohnungskrise und der Preis der Rechtsunsicherheit
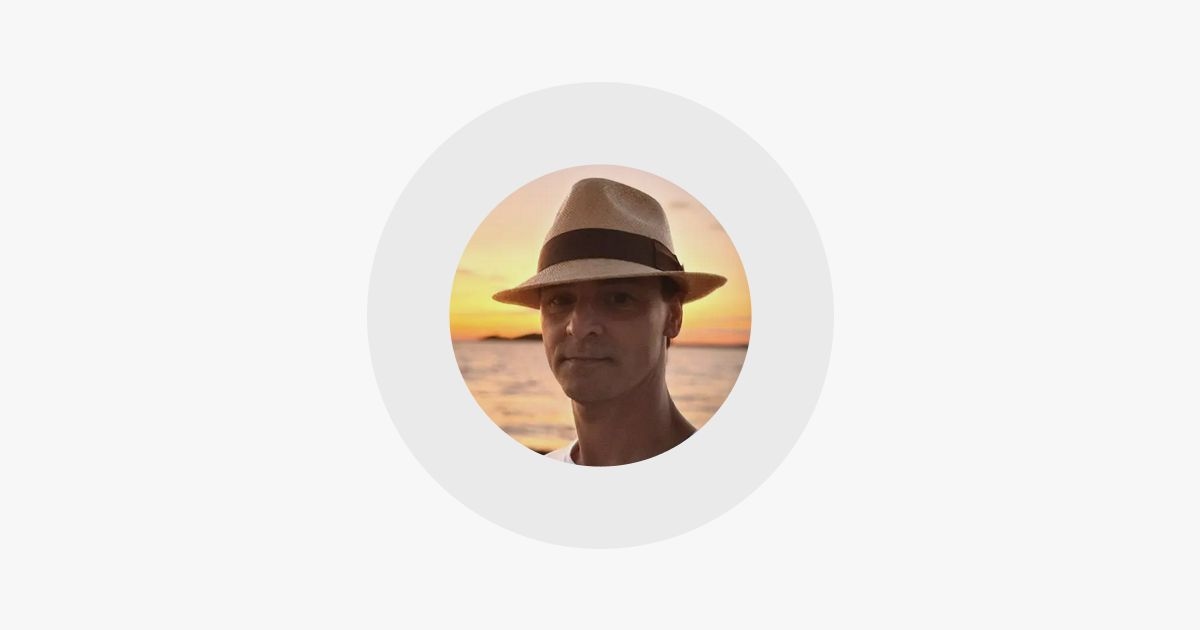
Jahrelang wurde Portugal glauben gemacht, das Wohnungsproblem ließe sich einfach durch besseren Mieterschutz lösen. Die Argumentation war simpel und verlockend: Vermieter hätten zu viel Macht über Mieter, und der Staat müsse eingreifen, um für mehr Ausgewogenheit zu sorgen. Das Ergebnis ist heute jedoch unbestreitbar: ein schrumpfender Mietmarkt, unerschwingliche Mieten und ein weit verbreitetes Misstrauen zwischen Vermietern und Mietern.
Die Politik der letzten Jahre, insbesondere unter dem Einfluss linker Regierungen – der bekannten „Geringonça“ (Linkskoalition) –, hat ein System geschaffen, in dem das Wohlwollen von Immobilieneigentümern ständig auf die Probe gestellt und selten belohnt wird. Aufeinanderfolgende Gesetzesänderungen – präsentiert unter dem Vorwand, die Schwächsten zu schützen – haben letztlich genau den Markt geschwächt, den sie eigentlich sichern sollten.
Der Wohnraummietvertrag, der eigentlich auf gegenseitigem Vertrauen beruhen sollte, ist zu einem riskanten Unterfangen geworden. Vermieter wissen, dass sie im Falle eines Zahlungsverzugs monatelang (oder sogar jahrelang) auf die Rückgabe ihres Eigentums warten müssen und dabei Fixkosten und steigende Verluste tragen müssen. Mieter wiederum wissen, dass der Staat seinen Schutz nahezu grenzenlos ausdehnt, selbst bei Missbrauch oder Zahlungsverzug. Dieses institutionalisierte Ungleichgewicht hat den grundlegendsten Anreiz für Wohnraumangebot zerstört: Sicherheit.
Das Ergebnis ist paradox. Im Bestreben, Mieter zu schützen, hat der Staat Vermieter vertrieben, das Angebot verringert und dadurch die Mieten immer weiter in die Höhe getrieben. Steigt das Risiko und wird das Gesetz zum Hindernis für die Rückgewinnung der Immobilie, verzichten viele ganz auf die Vermietung oder vermieten nur zu Preisen, die das Risiko ausgleichen. Andere nehmen ihre Immobilien vom Markt und bieten sie nur noch kurzfristig an oder lassen sie einfach leer stehen – eine vorhersehbare Folge einer Politik, die Schutz mit Bestrafung verwechselt hat.
Die Reduzierung der Entschädigung für verspätete Mietzahlungen von 50 % auf 20 % ist das perfekte Symbol für diesen Logikwandel. In einem Land, in dem Vertragsbruch beinahe als erworbenes Recht gilt, ist die Vertragserfüllung zu einer moralischen Entscheidung und nicht zu einer rechtlichen Pflicht geworden. Das Gesetz, das eigentlich Vorhersehbarkeit gewährleisten sollte, belohnt nun Nachlässigkeit und bestraft diejenigen, die sich an die Regeln halten.
Die Wohnungskrise ist daher weit mehr als eine Preisfrage. Es ist eine Vertrauenskrise. Ohne Vertrauen keine Investitionen, ohne Investitionen kein Angebot, ohne Angebot keine Lösung. Das Problem ist nicht der „freie Markt“ an sich, sondern ein Markt, der durch Regeln gehemmt wird, die den Eigentümer verdächtigen und den Zahlungsausfallenden als Opfer behandeln.
Wenn Portugal seine Wohnungskrise wirklich lösen will, muss es das tun, was es lange vermieden hat: Rechtssicherheit wiederherstellen und das Mietrecht neu ausrichten. Das bedeutet nicht, den Sozialschutz aufzugeben, sondern anzuerkennen, dass die Stabilität des Systems von denjenigen abhängt, die ihr Vermögen riskieren. Der Staat kann nicht immer mehr Wohnraum auf dem Markt fordern und gleichzeitig den Mietmarkt in ein Minenfeld der Unsicherheit und Bürokratie verwandeln.
Letztendlich ist das Problem nicht vom Himmel gefallen – es wurde Stein für Stein durch ebendiese politischen Maßnahmen geschaffen, die einen fairen Wohnungsmarkt anstrebten.
observador





