Das Recht auf die Burka oder der große blasierte Relativismus
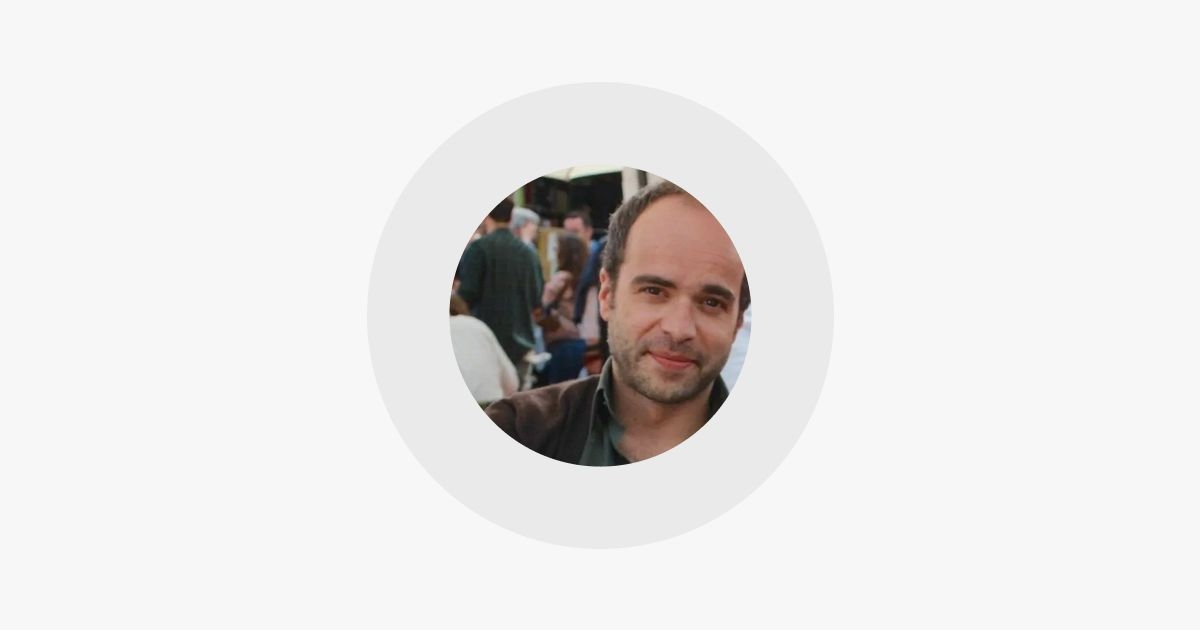
Wir werden alt, liebe Leserin, lieber Leser. Erinnern Sie sich noch an die fernen Tage des Jahres 2001, als die meisten von uns nach dem 11. September zum ersten Mal das Wort „Taliban“ hörten? Und wie empört wir damals waren, als wir die Burka entdeckten, das ultimative Symbol des Fundamentalismus dieses extremistischen Regimes, das Frauen nicht nur das Recht zu wählen, Auto zu fahren oder allein auf der Straße zu gehen verweigerte, sondern auch das Recht, gesehen zu werden, ein Gesicht, einen Körper, eine Wahl zu haben und sie zu bloßem Besitz eines Mannes degradierte, der alles tun und alles entscheiden kann?
Ach, wie die Zeit vergeht… Es scheint wie gestern, und doch sind wir hier, im Oktober 2025, und organisieren Demonstrationen in Lissabon für das Recht, die Burka zu tragen. Kommentatoren im Fernsehen bemerken lapidar , dass dies nicht unser Problem sei, dass es in Portugal kaum Burkas gäbe, dass das alles nur ein Manöver sei, um von den „wahren Problemen des Landes“ abzulenken, und dass manche es ja schließlich sogar mögen, Burkas tragen wollen – was geht uns das an? Wir sollten die Sitten und Gebräuche anderer respektieren.
Ja, die Zeit vergeht nicht nur für andere. Während einige Regime gewaltsam in die Vergangenheit zurückfielen, radikale Interpretationen des Islam annahmen, im Koran Dinge sahen, die nie darin standen, politische und religiöse Macht erneut bewusst verwischten und Feindseligkeit gegenüber westlichen Sitten schürten, bewegten auch wir uns in der Welt der jüdisch-christlichen Tradition, in der es bereits Jahrhunderte friedlicher Koexistenz gegeben hatte, nicht rückwärts, noch vorwärts, sondern vielleicht seitwärts oder im Kreis, irrational, wie jene, die nicht mehr wissen, wohin sie gehen sollen. Wie jene, die am Ende all ihrer moralischen Orientierungspunkte angelangt sind und noch nicht – werden sie es jemals sein? – in der Lage waren, einen neuen Katechismus, eine neue Philosophie, ein Verständnis von Gut und Böse im dritten Jahrtausend n. Chr. zu entwickeln.
„Zieht uns nicht die Burkas über die Augen!“, lautet der Slogan des von Raquel Varela organisierten Protests. Welch geistreiche Ironie, die an das andere brillante Mantra „Zieht uns nicht die Augen zu!“ erinnert, das uns so viele Erfolge im Management der öffentlichen Fluggesellschaft beschert hat! Die Gründerinnen und das Ziel der Bewegung sind zwar andere, aber die Grundhaltung ist dieselbe: Jemand, ein mythisches „Sie“, die „Macht“, versucht, uns zu täuschen! Zum Glück sehen diese Aktivistinnen, wie Tiresias, über das Offensichtliche hinaus und sind hier, um uns aufzuklären. Amina, eine junge Muslimin, die an demselben Protest teilnimmt, sagt gegenüber CNN: „Sie wollen uns vorschreiben, wie wir uns kleiden. Das ist nicht fair. Mein Körper gehört mir, also will ich selbst entscheiden, wie ich mich kleide.“ Und man stimmt ihr natürlich zu, nur um später zu erkennen, dass mit „Sie“ nicht die Taliban gemeint sind, sondern die Parteien, die in Portugal, wie auch in anderen Ländern, einen Gesetzentwurf eingebracht haben, der das Tragen der Burka oder jeglicher anderer Form der Gesichtsverhüllung im öffentlichen Raum verbietet. Und Amina merkt nicht, wie absurd das ist, was sie gerade gesagt hat. Und Raquel Varela merkt nicht, wie absurd es ist. Und sie machen weiter, wir alle machen weiter, glücklich, dem Absurden entgegen.
„Sie sind es, die Burka oder Niqab tragen wollen“, sagen manche Kommentatoren im Fernsehen und Internet – Megaphone, von denen Männer nur träumen können. Sie hätten in einer Ecke der Zivilisation diese Idee in ihren Häusern, ihren Frauen und Töchtern aufgezwungen und so viel Schrecken und Schuldgefühle geschürt, dass Gewalt überflüssig geworden sei. Alles sei domestiziert, alles zum Schweigen gebracht, marschiere in Herden, nun sogar begleitet von den wohlmeinenden Denkern eines abgeklärten westlichen Relativismus.
„Aber wie viele Frauen mit Burka haben Sie in Portugal gesehen? Das ist nicht unser Problem.“ Ich habe eine gesehen, liebe Leserin, lieber Leser, genau in dem Supermarkt, in dem ich einkaufe, und zwar ausgerechnet dort, als zufällig auch der Sohn eines ehemaligen Premierministers anwesend war. Von Kopf bis Fuß schwarz, neben mir, beim Aussuchen von Obst – jenes Bild, das wir noch 2001 auf dem Cover einer internationalen Zeitschrift sahen und das uns empörte. Aber jetzt: Ab wie vielen Burkas auf der Straße wird es zum Problem? Fünf? Zehn? Zwanzig? Hundert? Neunundneunzig waren kein Problem, aber bei der hundertsten verhängen wir Bußgelder? Und seit wann ist es uns egal, was jenseits unserer Grenzen passiert? Waren wir nicht alle für Menschenrechte, von Gaza bis zur Ukraine, von Osttimor bis zu denen, die vor nicht allzu langer Zeit die amerikanische Militärintervention im Irak verteidigten?
Die Burka ist kein religiöses Symbol, sondern ein Symbol eines extremistischen Regimes; sie steht nicht im Koran – und ich wünschte, sie stünde dort. Es ist schon seltsam, dass wir den Stierkampf als barbarischen mittelalterlichen Brauch betrachten, der dringend abgeschafft werden muss, während wir die Bräuche anderer als unantastbares kulturelles Erbe ansehen. Wir haben jeglichen moralischen Kompass verloren. Wir sind in der Evolution völlig verloren. Wir glauben allen Ernstes, dass es die Frauen waren, die beschlossen, sich von Kopf bis Fuß zu verhüllen, um arme Männer nicht in Versuchung zu führen. Vielleicht sehen wir ja eines Tages eine Burka bei einem Stierkampf und sind empört. Wie kann sie es wagen? Und ihr Mann? Ungeheuer! (Und wohlgemerkt, lieber Leser, ich genieße Stierkämpfe genauso sehr wie Zahnarztbesuche.)
Natürlich gibt es politische Opportunisten, die große Anliegen als Vorwand für ihre kleinlichen Interessen missbrauchen. Aber wollen wir ihnen weiterhin erlauben, sich Themen anzueignen, von denen wir uns im 21. Jahrhundert aus Feigheit oder moralischer Apathie fernhalten? Jedes Mal, wenn die Mitte, die es sich – seltsamerweise – noch immer bequem in ihrem Sessel gemütlich gemacht hat, untätig bleibt, rücken die Extreme vor. Wenn sie wirklich etwas zerstören wollen, sollen sie es doch tun.
observador





