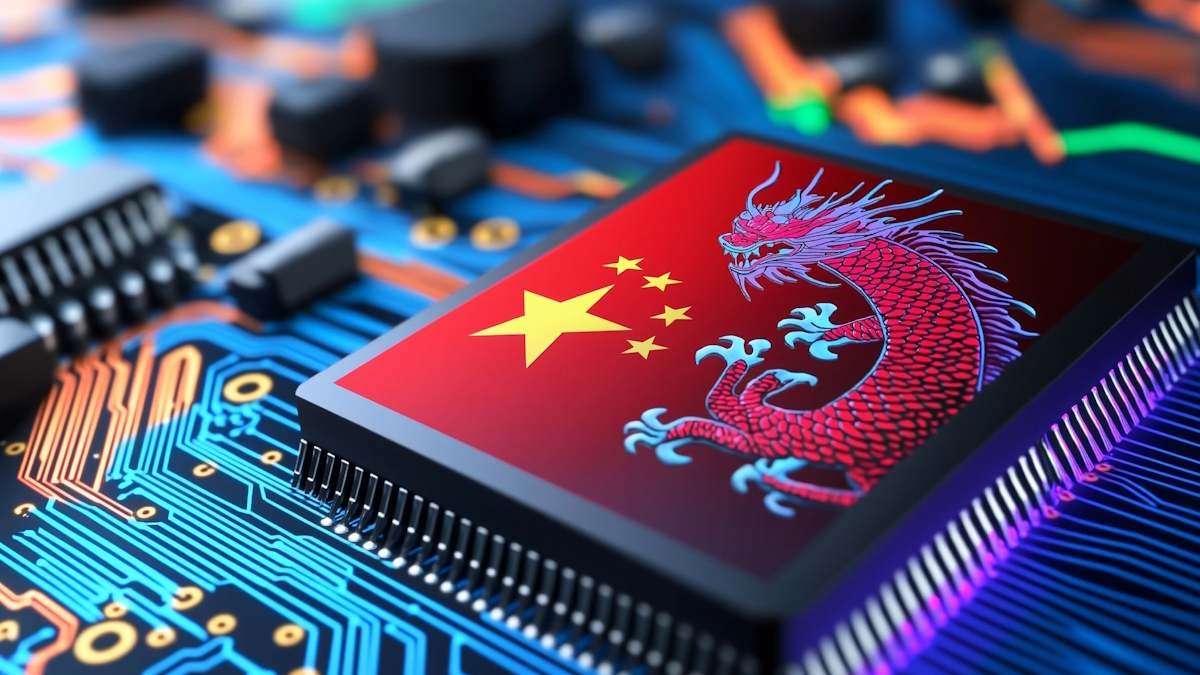Das reichste 1 % hat 41 % des seit dem Jahr 2000 geschaffenen Vermögens angehäuft; die ärmeren 50 % nur 1 %.

Die Welt erlebt einen „Ungleichheitsnotstand“. Das ist die zentrale Warnung des ersten Berichts zur Ungleichheit, der von der G20-Präsidentschaft in Auftrag gegeben wurde. Die am Dienstag vorgestellte Studie liefert neue Zahlen, die das Ausmaß des Problems verdeutlichen, und schlägt die Einrichtung eines unabhängigen internationalen Gremiums zur Bekämpfung von Ungleichheit vor, das die öffentliche Politik beraten soll.
„Wir haben das Gefühl, dass wir uns heute in einer Krise der Ungleichheit befinden, die viele Dimensionen hat, nicht nur wirtschaftliche, sondern auch demokratische“, erklärt der amerikanische Ökonom und Nobelpreisträger Joseph Stiglitz , Präsident des sechsköpfigen Expertenkomitees, das den Bericht erstellt hat und den gegenwärtigen Moment mit einer hohen Konzentration des Reichtums bei den Privilegiertesten als „Wendepunkt“ bezeichnet, in einem Telefoninterview.
Die Studie, erstellt vom Außerordentlichen Komitee unabhängiger Experten für globale Ungleichheit und in Auftrag gegeben vom südafrikanischen Präsidenten Cyril Ramaphosa während Südafrikas G20-Präsidentschaft, zeigt, dass zwischen 2000 und 2024 das reichste Prozent der Weltbevölkerung 41 % des gesamten neu geschaffenen Vermögens anhäufte, während nur 1 % an die ärmsten 50 % ging. Diese Berechnungen basieren auf Daten des World Inequality Lab. „Das heutige Wirtschaftssystem bietet weder Wohlstand noch Würde oder eine angemessene Sozialpolitik für die Mehrheit der Weltbevölkerung“, erklärt Adriana E. Abdenur, brasilianische Sozialwissenschaftlerin, Mitbegründerin von Plataforma CIPÓ und eine der Autorinnen des Berichts, in einem Videointerview.
„Das erfordert eine entschiedene Reaktion, wenn wir nicht in einen Teufelskreis geraten wollen, in dem, sobald die Ungleichheit zu groß ist, die Reichen die Spielregeln so festlegen , dass sie ihren Reichtum erhalten können. Es wird sehr schwierig sein, da wieder herauszukommen“, fügt Stiglitz hinzu.
Einkommens- und Vermögensungleichheit führt zu Ungleichheiten in den Bereichen Gesundheit, Zugang zur Justiz und Chancen.
Joseph Stiglitz, amerikanischer Ökonom und Nobelpreisträger für Wirtschaftswissenschaften
Darüber hinaus stieg das Vermögen des reichsten Prozents seit dem Jahr 2000 um durchschnittlich 1,3 Millionen US-Dollar (ca. 1,12 Millionen Euro), verglichen mit durchschnittlich 585 US-Dollar (ca. 508 Euro) für die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung. „Mit anderen Worten: Es ist kein Wunder, dass so viele Menschen weltweit das Gefühl haben, ihr Lebensstandard sei stagniert und das Leben werde zunehmend unerschwinglich. Dies hängt eng mit der dramatischen Konzentration des Vermögens beim obersten Prozent der Bevölkerung zusammen“, betont Abdenur. „Einkommens- und Vermögensungleichheit schlägt sich in Ungleichheiten bei Gesundheit , Zugang zur Justiz und Chancen nieder“, unterstreicht Stiglitz.
83 Prozent der Länder, die 90 Prozent der Weltbevölkerung repräsentieren, erfüllen die Definition der Weltbank für hohe Ungleichheit. Während die Ungleichheit zwischen Einzelpersonen weltweit dank des Einkommenswachstums in einigen Ländern wie China leicht abgenommen hat, ist die Ungleichheit innerhalb der Länder sprunghaft angestiegen. Darüber hinaus bleibt die Einkommenskluft zwischen dem globalen Norden und Süden weiterhin sehr groß.
Das Komitee unter dem Vorsitz des Wirtschaftsnobelpreisträgers stützte seine Erkenntnisse auf Konsultationen mit rund 80 führenden Ökonomen und Ungleichheitsexperten. Deren Schlussfolgerungen zeichnen ein düsteres Bild. Das Vermögen der Milliardäre entspricht heute 16 % des globalen BIP und hat damit einen Höchststand erreicht. Demgegenüber sind 25 % der Weltbevölkerung, umgerechnet 2,3 Milliarden Menschen, von mäßiger oder schwerer Ernährungsunsicherheit betroffen; das heißt, jeder Vierte muss regelmäßig Mahlzeiten auslassen. Dies entspricht einem Anstieg um 335 Millionen seit 2019.
Diese zunehmende Ungleichheit steht in klarem Zusammenhang mit der Aushöhlung der Demokratie. „In einigen Bereichen erzielen wir Erfolge, in anderen scheitern wir, etwa bei der Konzentration von Reichtum an der Spitze, was besonders gefährlich für das Funktionieren unserer Demokratie ist“, betont Stiglitz.
Laut der Studie ist die Wahrscheinlichkeit eines Demokratieverlusts in Ländern mit hoher Ungleichheit siebenmal höher als in Ländern mit größerer sozialer Gerechtigkeit. „Dies war eine der zentralen Schlussfolgerungen unserer Analyse: Extremer Reichtum, wie wir ihn derzeit weltweit beobachten, ist nicht nur ein Mittel zum Zweck für einen komfortableren Lebensstil. Wirtschaftliche Ungleichheiten führen in der Regel zu politischen Ungleichheiten, beispielsweise beim Zugang zur Justiz oder bei der Mitbestimmung in politischen Prozessen“, erklärt Abdenur.
„Dieses Problem wird durch das Aufkommen großer Technologieplattformen verschärft, die die Kontrolle über die sozialen Medien – sozusagen den öffentlichen Raum des 21. Jahrhunderts – in die Hände einiger weniger Milliardäre gelegt haben“, fügt er hinzu. „[Technologieunternehmen]“, erklärt Stiglitz, „beeinflussen die Politik nicht nur auf die übliche Weise, indem sie Wahlkämpfe und Politiker beeinflussen oder finanzieren, sondern auch indirekt, indem sie die Medien, einschließlich der sozialen Netzwerke, kontrollieren. Das ist sehr wichtig, denn Algorithmen bestimmen, was die Menschen sehen, und das wiederum bestimmt, wie sie die Welt wahrnehmen“, fügt er hinzu.
„In meinem Land, Brasilien, sehen wir, dass die mangelnde Regulierung großer Technologieplattformen eine Konzentration von Reichtum ermöglicht, die unseren demokratischen Prozess untergräbt. Aber das ist nicht nur in Brasilien so. Das passiert sowohl in reichen als auch in Entwicklungsländern“, betont Abdenur.
Vermögensungleichheit ist keine vorübergehende Krise, sondern ein generationenübergreifendes Problem. Und wenn wir es jetzt nicht angehen, wird sich die Situation in den kommenden Jahrzehnten verschärfen.
Adriana E. Abdenur, brasilianische Sozialwissenschaftlerin und Mitbegründerin der Plataforma CIPÓ
Darüber hinaus zeigen aktuelle Daten zum Anstieg des Erbvermögens , dass in den nächsten zehn Jahren 70 Billionen US-Dollar an Erben fließen werden. „Dies stellt eine große Herausforderung für soziale Mobilität, Gerechtigkeit und Chancengleichheit dar. Vermögensungleichheit ist keine vorübergehende Krise, sondern ein generationenübergreifendes Problem. Wenn wir jetzt nicht handeln, wird sich die Situation in den kommenden Jahrzehnten verschärfen“, warnt der Mitautor des Berichts. „Ungleichheit ist ein Verrat an der Menschenwürde, ein Hindernis für inklusives Wachstum und eine Bedrohung für die Demokratie selbst. Ihre Bekämpfung ist eine unumgängliche generationenübergreifende Herausforderung“, erklärte Ramaphosa in einer Pressemitteilung.
Experten schlagen Maßnahmen in drei Bereichen zur Bekämpfung von Ungleichheit vor. Auf internationaler Ebene fordern sie eine Reform der globalen Wirtschaftsregeln, von Regelungen zum geistigen Eigentum (insbesondere bei Themen wie Pandemien und Klimawandel) bis hin zur Neufassung der Steuerregeln, um eine gerechtere Besteuerung multinationaler Konzerne und sehr wohlhabender Menschen zu gewährleisten.
Auf nationaler Ebene fordern sie die Förderung arbeitnehmerfreundlicher Regelungen, den Abbau von Unternehmenskonzentration, die Besteuerung hoher Kapitalgewinne, Investitionen in öffentliche Dienstleistungen und die Einführung progressiverer Steuerpolitiken. Schließlich plädieren sie für neue Modelle der Zusammenarbeit zwischen den Ländern in den Bereichen Finanzen, Handel und ökologischer Wandel.
Ein ExpertengremiumEine der wichtigsten Schlussfolgerungen des Ausschusses, so Stiglitz, sei der „Mangel an Analysen, Daten und Beobachtung sowohl kurz- als auch langfristiger Trends sowie an der Identifizierung der Ursachen von Ungleichheit und an Vorschlägen für politische Maßnahmen zu deren Bekämpfung“. „Wir befinden uns in einer Ungleichheitskrise, und um sie zu bekämpfen, benötigen wir ein solideres Fundament für ihr Verständnis“, fügt er hinzu.
Daher empfehlen sie der G20 als vorrangige Forderung die Einrichtung eines Internationalen Gremiums für Ungleichheit (IPI) nach dem Vorbild des Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaänderungen (IPCC). „Wir sind der Ansicht, dass angesichts dieser Ungleichheitskrise etwas Ähnliches [wie der IPCC] notwendig ist, eines, das technische Expertise bündelt, um nicht nur die vorliegenden Beweise zu bewerten, sondern auch dazu beizutragen, bessere und umfassendere Daten zu erheben“, erklärt Abdenur.
Der südafrikanische Professor Imraan Valodia von der Universität Witwatersrand (WITS) und Mitautor des Berichts stimmte dem in einer Stellungnahme zu: „Viele Schätzungen scheinen das Ausmaß deutlich unterschätzt zu haben. Ohne angemessene Überprüfung ist die Ungleichheit außer Kontrolle geraten, und es ist an der Zeit, etwas dagegen zu unternehmen.“
„Wir brauchen ein ständiges Forum für unabhängige Experten, um die vorliegenden Erkenntnisse zu bewerten und Ideen zu entwickeln, die Ländern im Kampf gegen Ungleichheit helfen“, fährt Abdenur fort. „Es geht nicht nur um eine akademische Übung. Es ist nützlich für politische Entscheidungsträger, die Zivilgesellschaft, die Privatwirtschaft, die Wissenschaft und die Medien“, fügt sie hinzu. Denn für die Expertin gilt: „Ungleichheit zu verstehen ist eine technische Angelegenheit; sie zu bekämpfen ist eine politische Entscheidung.“
EL PAÍS