Don Quijote, Ironie und das Haupt des Orpheus
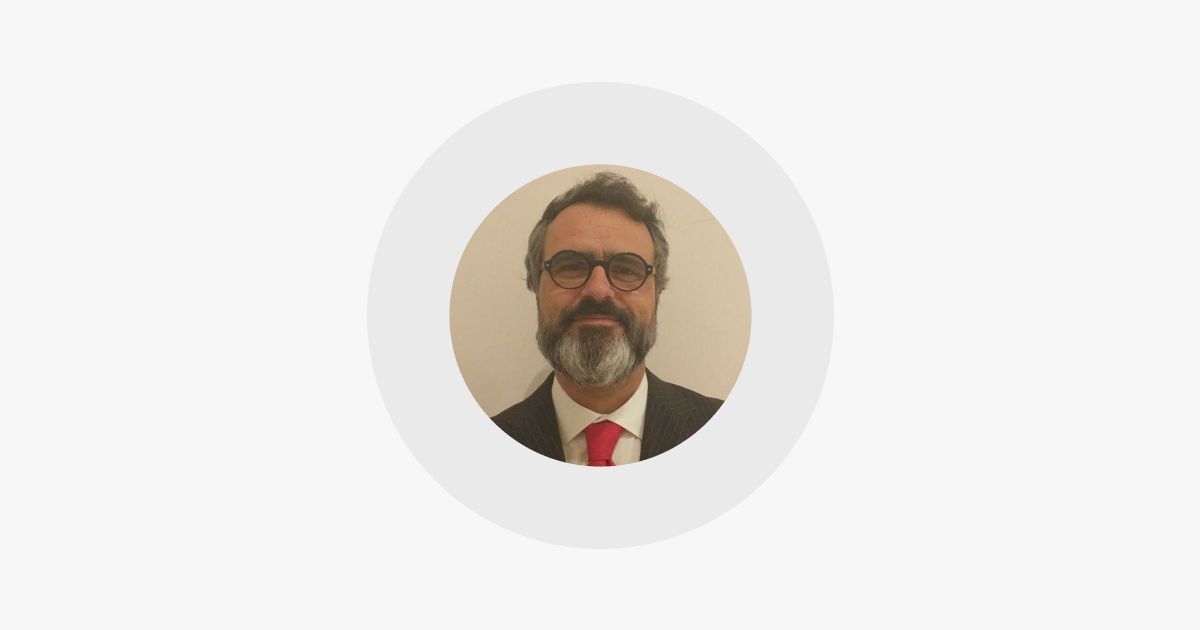
Eine meiner Lieblingsstellen aus Don Quijote spielt in der Sierra Morena: Quijote springt über die Felsen und ahmt damit jene Ritter nach, die wie Amadis und Orlando aus Eifersucht in den Wahnsinn getrieben wurden und die wahnsinnigsten Taten begingen. Sancho fragt ihn, warum er sich so unnötig verhalten habe, da er doch keinen Grund habe, sich von seiner Dulcinea verachtet zu fühlen. Worauf Quijote antwortet: „Das ist der springende Punkt und die Feinheit meiner Angelegenheit: Für einen fahrenden Ritter ist es weder Ehre noch Anmut, aus einem bestimmten Grund in den Wahnsinn zu verfallen. Der Trick besteht darin, ohne Grund verrückt zu sein.“
Dieser „unvernünftige Wahnsinn“ ist der Schlüssel zu Cervantes’ Buch. Das Wörterbuch definiert „Wahnsinn“ als „Wahnsinn, Absurdität oder Irrtum“. Doch bei Cervantes hat er eine ganz andere Bedeutung. Wie die absurden Gesten eines Zen-Meisters hat Don Quijotes Wahnsinn die Macht, das Realitätsprinzip vorübergehend außer Kraft zu setzen. Seine Funktion besteht darin, eine Lücke in der Logik zu öffnen und uns zum tiefen und unmittelbaren Verständnis einer neuen Wahrheit zu führen. Daher entscheidet sich Don Quijote zwischen den beiden Vorbildern, die ihm in der Sierra Morena begegnen, dem von Amadis und dem von Orlando, ohne zu zögern für Ersteres: Orlando, verzweifelt über Angelicas Verrat, verändert den Lauf von Flüssen, verwüstet Wälder und vernichtet Vieh; während Amadis „Wahnsinn nicht des Schadens, sondern der Tränen und Gefühle“ begeht. Dies ist der Weg Don Quijotes, für den Abenteuer nie einen Bruch mit der Realität bedeuten, sondern vielmehr ihre Verherrlichung. Daher ist sie untrennbar mit der Freude verbunden, die entsteht, wenn man die Dinge nicht in den Kategorien „wahr“ oder „falsch“ betrachtet, sondern in der Erkenntnis. Torheit ist eine Bedingung des Paradieses, denn sie macht die Welt zu einem Ort der Möglichkeiten.
Es hat nichts mit Wahnsinn zu tun. Wahnsinn bedeutet, keine Rücksicht auf andere zu nehmen, und nur wenige Helden nahmen sie so ernst wie Don Quijote. Die große Lehre aus seinen Abenteuern ist, dass eine Welt ohne Gerechtigkeit wertlos ist; ebenso wenig aber eine Welt ohne Gnade, die nichts anderes ist als die zweite Chance, die wir den Dingen geben, damit sie endlich das sein können, was sie sein können. Don Quijote ist der Ritter dieser zweiten Chance, und deshalb gibt es nur wenige Helden, die redseliger sind als er, denn diese zweite Chance spielt sich immer in der Sprache ab. Man könnte sogar sagen, er tut alles aus dem Wunsch heraus, nie mit dem Reden aufzuhören, und dieses Reden selbst – immer etwas zu sagen und jemanden zu finden, dem er es sagen kann – ist sein Grund, ein Ritter zu sein. Neben den Namen, die er so verdient – Ritter der traurigen Gestalt, Ritter der Löwen –, hätte er sich also treffender Ritter des Wortes nennen können.
Doch er bietet auch seinen Körper an, den Körper, den die Frau, die er am meisten liebte, zurückwies: Er verliert Speere, Schilde, Helme, Rüstungsteile und wird unzählige Male geschlagen und verwundet. Nur wenige Figuren in der Literaturgeschichte haben eine solche Spur hinterlassen, so dass man fast sagen könnte, es gibt kein Abenteuer, das er beginnt, ohne etwas von sich selbst zu hinterlassen. Mit anderen Worten: Er redet nicht nur. Wenn er an der Reihe ist, zahlt er den Preis. Und darin liegt die Ironie: Der Ritter, der einen Fehler nach dem anderen begeht, ist auch derjenige, der letztendlich mit seinen Worten und Taten all das Unaussprechliche, Edle und Schöne in uns offenbart.
Ironie ist für Cervantes die Fähigkeit, die Widersprüche des Lebens zu akzeptieren; kurz gesagt, zu akzeptieren, dass nichts nur auf eine bestimmte Art und Weise existiert. Deshalb wird Don Quijote nie müde , Fragen zu stellen. Er fordert schmutzige Gastwirte auf, höfliche Gastgeber zu sein; arme Dienstmädchen, geheimnisvoll und süß zu sein; die dürren und kargen Felder der Mancha, ins Goldene Zeitalter zurückzukehren, und den Nachttopf eines Barbiers, sich in einen goldenen Helm zu verwandeln. Seine Stärke rührt stets aus dem Glauben, dass die Welt viel besser ist, als sie ist, als könnten wir die Dinge nur in das verwandeln, was sie hätten sein sollen, indem wir ihre wahre Natur ignorieren.
In gewisser Weise gleicht Don Quijote Orpheus, der mit seinem Gesang Flüsse zum Stillstand bringt, Äste vor ihm beugt und Tiere das Grasen vergessen lässt. Orpheus wird von den Bacchantinnen zerrissen, und die Sage erzählt, wie sein Haupt weitersingt, während es von den Wassern fortgerissen wird. Weder Don Quijote noch Orpheus hören auf zu beten, denn sie lieben das Leben so sehr, dass sie sich gegen die Unvollständigkeit ihrer eigenen Erfahrung auflehnen müssen. Quijote möchte die Welt in ein wunderschönes Buch voller Abenteuer verwandeln, und Orpheus möchte mit seinem Gesang eine neue Sprache erfinden, die sie lebenswert macht. Im Nachhinein betrachtet, ist es genau das, was ein Leser tut: Er vollzieht den höchsten Akt des Gebets , das Lesen, getrieben von der Sehnsucht nach einer unmöglichen Gesamtheit. Er liest, um die Wahrheit der Sinnlosigkeit des Lebens zu leugnen und weil er nicht möchte, dass Dinge wie Güte, Liebe und Vergebung in der Welt aufhören zu existieren.
Und darin unterscheiden sich Leser nicht von Kindern. Auch sie werden nicht müde zu fragen : Sie sehen einen Spiegel und bitten um eine Tür zu einer anderen Welt; sie sehen einen Landstreicher und möchten von ihm eine Karte einer verlorenen Insel erhalten; ein Vogel fliegt durch das Fenster, und sie fragen nach Neuigkeiten aus dem Garten, wo die Vögel sprechen und die Bäume singen; sie gehen zum Metzger und bleiben vor den Köpfen der geopferten Lämmer stehen, als würden diese ihnen ihre traurige Geschichte zuflüstern. Es ist nicht so, dass sie nach Dingen suchen; sie finden sie, ohne es zu merken. Denn es geht nicht darum, von Büchern zu erwarten, dass sie uns entscheidende Wahrheiten über das Leben vermitteln, sondern darum, sie zu lesen, ohne zu wissen, was wir uns davon erhoffen, wenn überhaupt etwas. Deshalb sind gute Bücher nutzlos. Sie helfen uns nicht, die Welt zu verstehen, sie machen uns nicht weiser, sondern versetzen uns in diesen Cervant-ähnlichen Zustand der Ratlosigkeit.
Wir erreichen Bücher wie magische Inseln, nicht weil uns jemand an die Hand nimmt, sondern einfach, weil sie uns begegnen. Lesen ist, wie Lieben, ein unerwartetes Ankommen an einem neuen Ort. Ein Ort, von dem wir, wie von einer verlorenen Insel, nichts wussten und an dem wir nicht vorhersagen können, was uns erwartet. Ein Ort, den wir still und mit offenen Augen betreten müssen, wie Kinder, die ein verlassenes Haus betreten.
Und an dieser Stelle hilft uns Don Quijote immer wieder weiter. Er lehrt uns, dass es zwei Arten von Lügnern gibt: diejenigen, die sich verkleiden, um die Wahrheit zu verschweigen, und diejenigen, die ihr folgen, wohin sie auch führt. Die maskierten Figuren aus Filmen und Comics, die wir als Kinder vergötterten, gehörten zum zweiten Typ. Sie gaben sich als andere aus und rebellierten dank dieser neuen Identität gegen Ungerechtigkeit, machten den Traurigen Freude und boten ihren Geliebten ihren neuen Körper an. Don Quijote, der Ritter des Wortes, ist eine dieser maskierten Figuren, deren Wahnsinn die Macht besitzt, der Wahrheit Flügel zu verleihen.
observador





