Die seltsame Haushaltsnormalität eines undisziplinierten Landes.
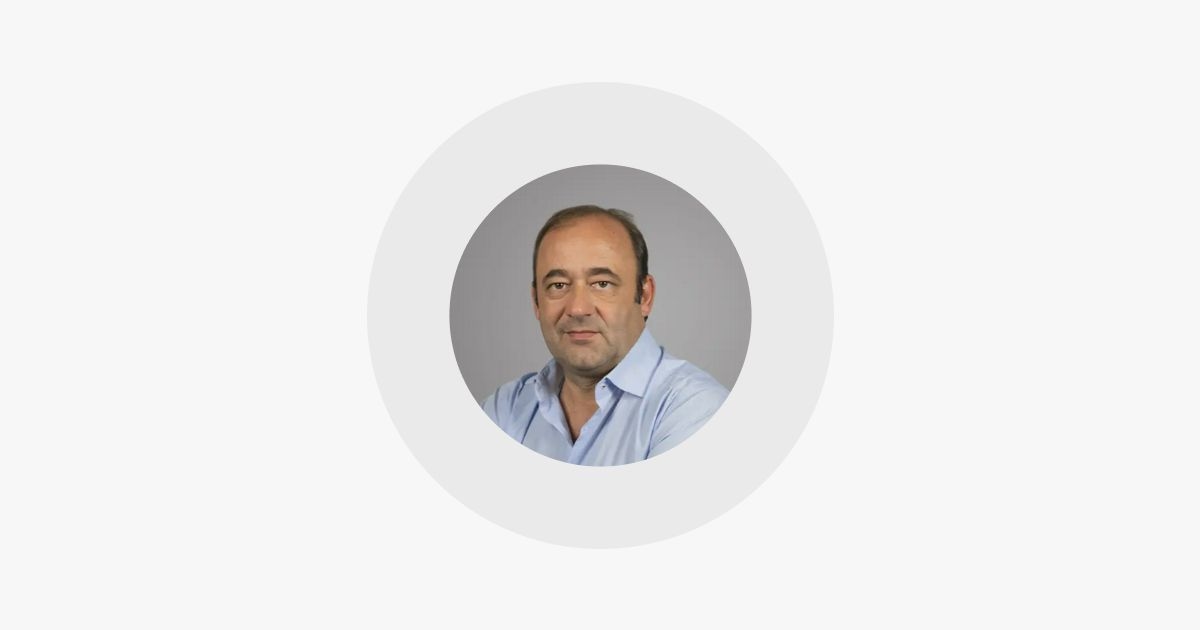
Es ist unfair zu behaupten, das Land führe keine Strukturreformen durch. Zwar werden nicht alle notwendigen Reformen umgesetzt, das stimmt, aber eine wurde in den letzten 15 Jahren erreicht: der breite Konsens über die Notwendigkeit, einen ausgeglichenen Haushalt oder leichte Haushaltsüberschüsse vorherzusehen und zu erzielen.
Dieser Ausgangspunkt hat sich in Haushaltsdiskussionen etabliert. Wir können und sollten darüber diskutieren, wohin die Ausgaben fließen und welche Steuern erhoben werden sollen, ohne jedoch den Haushaltssaldo zu verändern, der positiv sein sollte.
Dieser Weg begann im Jahr 2011 mit der harten Umsetzung der im Rahmen des Finanzrettungsprogramms auferlegten Bedingungen und hat sich bereits über mehrere Regierungen und politische Situationen erstreckt.
Ich räume ein, dass der Weg zum Gleichgewicht letztlich nur eine halbe Strukturreform darstellt. Warum? Weil die Anpassung die laufenden öffentlichen Ausgaben, die strukturell Jahr für Jahr gestiegen sind, nicht berührte und ausschließlich mit den einfachsten Variablen erfolgte: höheren Steuern und pauschalen Investitionskürzungen.
Dennoch stellt die Festlegung des Ziels der Haushaltsneutralität einen bedeutenden Kulturwandel dar. Es handelt sich um ein Prinzip, denn bekanntlich bestand unsere bisherige Lebensweise darin, die Ausgaben zu erhöhen, die Steuern anzuheben und hohe Defizite anzuhäufen, die sich zu Schulden auftürmten. Bis dies nicht mehr tragbar war – und der Rest ist Geschichte.
Der Unterschied zwischen der Zeit vor und nach dem Konsens über einen ausgeglichenen Haushalt – der ironischerweise unter einer von der extremen Linken unterstützten Regierung erzielt wurde – ist frappierend. Früher wurde darüber debattiert, welche Steuern erhöht werden sollten; heute geht es darum, welche Steuern gesenkt werden sollten. Früher gab es Versuche, das Defizit zu verschleiern, um Sanktionen aus Brüssel zu entgehen; heute gehören wir zu den Eurozonenländern mit den ausgeglichensten Haushalten. Früher wurden Schuldenobergrenzen mit dem alten Grundsatz „Schulden werden verwaltet, nicht bezahlt“ erprobt; heute wissen wir, dass es so nicht funktioniert, und Finanzminister präsentieren gern immer niedrigere Schuldenquoten.
Wir sind an einem Punkt angelangt, an dem eine Regierung mit sinkender Popularität und schlechteren Wahlergebnissen bestraft werden kann, wenn sie ohne triftigen Grund – beispielsweise eine Pandemie? – Haushaltsdefizite anhäuft. Wir wissen es nicht, aber es ist eine Hoffnung, die wir hegen sollten.
Und wir müssen dies fördern, denn der nächste Schritt wird unweigerlich eine Reform der öffentlichen Ausgaben erfordern. Ohne das Haushaltsdefizit als Anpassungsgröße und angesichts der bereits bestehenden hohen Steuerbelastung werden zukünftige Anpassungen eine Rationalisierung der öffentlichen Ausgaben notwendig machen. Dies erfordert keine nominalen Ausgabenkürzungen. Es genügt, dass die öffentlichen Ausgaben Jahr für Jahr langsamer steigen als das nominale BIP-Wachstum.
Genau das ist mit den Schulden passiert. Der Betrag steigt zwar Jahr für Jahr, aber sein Gewicht in einer wachsenden Wirtschaft nimmt immer weiter ab.
Zu dieser Normalität des Haushaltsgleichgewichts gesellt sich nun die Normalität des Haushaltsverfahrens. Der Staatshaushalt ist und kann keine jährliche Vertrauensabstimmung sein, der sich Minderheitsregierungen unterwerfen müssen. Der Haushalt muss in erster Linie die finanziellen Verpflichtungen des Staates und die geltenden Gesetze widerspiegeln. Der verbleibende, relativ geringe Spielraum muss dann die politischen Entscheidungen widerspiegeln, die jede Regierung im Einzelfall trifft.
In den letzten Jahren haben wir uns daran gewöhnt, den Haushalt als das einzige legislative Ereignis des Jahres zu betrachten, in dem alle sektoralen Politiken und Hunderte von isolierten Maßnahmen, die wenig oder gar nichts mit dem Haushalt zu tun hatten, angehäuft wurden.
Vor einem Jahr brachten die politischen Parteien im Rahmen der Sonderdebatte zum Haushalt rund 2.000 Änderungsanträge ein. Beispiele hierfür sind: die jährliche Überprüfung des Gesundheitszustands von Sicherheitskräften, der Stopp der Privatisierung der portugiesischen Fluggesellschaft TAP, die Förderung der Teppichweberei in Arraiolos und der Figurenbildhauerei in Estremoz, die Modernisierung der Zahlungsmodalitäten für Anträge auf Krankmeldungen, die Überprüfung der Laufbahn von Steuerfahndern und vieles mehr.
Das Ergebnis dieser Praxis ist eine äußerst schlechte Qualität der Gesetzgebung – die Abgeordneten des Parlaments schenkten in ihren langen Marathonsitzungen dem, worüber sie abstimmten, wenig Beachtung – und es mangelte an einer unabhängigen Diskussion der einzelnen Vorschläge.
José Luís Carneiro handelte richtig, als er die Ausklammerung relevanter Angelegenheiten wie der Überarbeitung des Arbeitsrechts, Änderungen der Sozialversicherung oder Umstrukturierungen des Nationalen Gesundheitsdienstes aus dem Haushalt zur Bedingung für die Regierungsentscheidung machte. Dies sind allesamt Angelegenheiten von großer Bedeutung, die nur davon profitieren, getrennt vom Haushalt diskutiert und entschieden zu werden.
Und Joaquim Miranda Sarmento hatte Recht, als er einen Haushalt aufstellte und vorlegte, der letztendlich eben nur das ist: ein Haushalt. Wir waren so sehr an die vorherigen schlechten Praktiken gewöhnt, dass wir jetzt sogar überrascht sind, alles an seinem Platz zu sehen.
observador





