Die russischen Truppen waren von der Fülle am Stadtrand von Kiew überwältigt. Daher die Grausamkeit?

„Russland hat mir unter anderem meine Vorstellungskraft genommen. Ich bin jetzt nicht mehr in der Lage, Romane zu schreiben“, sagte der ukrainische Schriftsteller Oleksandr Mykhed gegenüber PAP. Er glaubt, dass Russland auch nach dem Ende des Krieges nicht verschwinden wird und auch sein Hass auf die Nachbarländer nicht verschwinden wird.
PAP: Was hat Sie dazu inspiriert, das Buch „Kotek, Kogutek, Szafka“ zu schreiben?
Oleksandr Myched: Die Inspirationsquelle war die Befreiung der Oblast Kiew von der russischen Besatzung im April 2022. Es war wichtig, die schrecklichen Verbrechen der russischen Truppen damals festzuhalten. Außerdem verbrachten meine Eltern drei Wochen unter Besatzung in Butscha. Das Kätzchen, der Hahn und der Schrank sind Symbole, die die Ukrainer mit dem Beginn eines umfassenden Krieges verbinden. Der Schrank war zusammen mit dem Keramikhahn auf einem sehr beliebten Foto eines zerstörten Wohnhauses in Borodino zu sehen. Von dem Gebäude ist außer dem Hängeschrank praktisch nichts mehr übrig. Das Kätzchen, das mit bürgerlichem Namen Gloria heißt, wurde in einer zerstörten Wohnung im 6. oder 7. Stock gefunden – allein, wie auf einer einsamen Insel.
PAP: Woher kam die Idee, solch tragische Ereignisse in einem Märchenformat zu erzählen?
OM: Ich nenne es ein Sachmärchen. Ich ging davon aus, dass sich die drei Titelfiguren in einer Wohnung treffen, miteinander reden und möglicherweise den Verlauf der Kriegsereignisse und die Beziehung zwischen Enkelin und Großmutter beeinflussen. Dieses Thema der generationsübergreifenden Erfahrung des Überlebens im Krieg war mir wichtig. Ein großer Teil des Buches basiert auf dokumentarischem Material, da meine Eltern mir viele Geschichten aus der Besatzungszeit erzählten, und es gibt auch Bilder, die mir aus den Medien bekannt sind. Märchen sind zwar ein Kindergenre, aber ich denke, sie sind auch für erwachsene Leser ab elf Jahren geeignet.
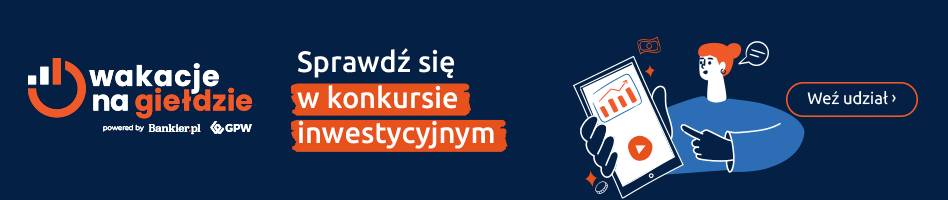
PAP: „Eine grüne, grüne Stadt“ – so beschrieben Sie Borodsjanka vor der groß angelegten Invasion. Heute ist die Stadt schwer vom Krieg zerstört, symbolisiert durch ein Denkmal für Schewtschenko mit einer Schusswunde im Kopf. Wie war das Leben dort vorher?
OM: Ich kenne Borodsjanka nicht so gut wie Hostoml oder Bucha, wo ich einige Jahre gelebt habe. Vor dem Krieg galt Bucha als grüne Stadt. Paradoxerweise waren die russischen Truppen 2022 ziemlich überrascht, dass sich die Außenbezirke von Kiew so gut entwickeln konnten. Sie waren entsetzt über den Wohlstand und den Lebensstandard. Man darf auch nicht vergessen, dass diese Städte in der Nähe von Kiew zuvor Binnenflüchtlingen aus Donezk, Luhansk und der Krim als Zuhause dienten, die die Besatzung bereits 2014 überlebt und ihre Häuser verloren hatten. Sie begannen, sich in den Außenbezirken von Kiew ein neues Leben aufzubauen.
PAP: Der Krieg hat die Wahrnehmung von Bucza, Hostoml, Irpień und Borodzianka für immer verändert, da sie mit Völkermord und dem Bösen des Krieges in Verbindung gebracht werden. Ist es möglich, zu diesem Bild von vor 2022 zurückzukehren?
OM: Ich halte es für sinnlos, von einer Rückkehr in die Vergangenheit zu sprechen, denn diese Orte haben auf verschiedenen Ebenen enorme Verluste erlitten. Ich meine das Gefühl von Sicherheit, den Verlust von Angehörigen, Eigentum und Gebäuden. Ich halte eine Rückkehr zu dem, was einmal war, für unmöglich. Die Bewohner, die dort geblieben sind, wollen weitermachen, aber gleichzeitig ist es unmöglich, sich von diesen Tragödien zu trennen, weil die Erinnerungen ständig präsent sind, zum Beispiel in den abgerissenen Gebäuden. Emotional leben diese Menschen an einer Grenze, an einem Scheideweg der Erfahrungen.
PAP: In dem Buch geht es um Onkel Andrij, der nach der russischen Invasion zum ersten Mal in seinem Leben genau weiß, was er tut: Er bricht mit einem Rucksack auf und meldet sich bei der Armee. Glauben Sie, dass dieser Krieg für manche ein Anstoß war, dem Leben einen Sinn zu geben?
OM: Andriy ist ein eindrucksvolles Beispiel für jemanden, der im Krieg zu sich selbst gefunden hat. Denn es ist eine Zeit, in der es keinen Raum für Zweifel oder Zögern gibt. Es ist schwarz und weiß: Es gibt Krieg und ein Land, das es zu verteidigen gilt. Ich denke, es gibt tatsächlich viele einfache Menschen, die in einer gewissen Passivität und Untätigkeit gelebt haben und sich während des Krieges in dieser Art von Brüderlichkeit, in der gemeinsamen Verteidigung, wiedergefunden haben – im Wirbelsturm der Geschichte haben sie sich selbst gefunden. Das bedeutet nicht, dass sie für immer Soldaten bleiben werden, denn nach dem Krieg werden sie wahrscheinlich in ihren zivilen Beruf zurückkehren, nur mit anderen Erfahrungen.
PAP: Warum sind Sie gleich zu Beginn des Krieges zur Armee gegangen? In „Codename for Job“ haben Sie zugegeben, dass Sie bis 2022 keine Waffe in der Hand halten würden.
OM: Eine solche Entscheidung trifft jemand, der versteht, dass alles Vorherige seine Bedeutung verloren hat. Es ist eine Art Ground Zero, wo man sich neuen Herausforderungen stellt. Es gab einfach keine andere Möglichkeit; meine Eltern waren in Butscha besetzt, und die Russen rückten vor, daher war es für mich offensichtlich, dass ich handeln musste. Ich verstand, dass Russland für Artilleriebeschuss, Verbrechen und materielle Zerstörung stand, aber auch für den Versuch, die ukrainische Kultur zu vernichten. Wie wichtig Kultur für die Identität einer Nation ist, zeigen die Verbrechen der Russen, die Denkmäler zerstören, Kunstwerke stehlen und Bibliotheken angreifen.
PAP: Können Sie beschreiben, was Ihr Dienst in den Streitkräften der Ukraine beinhaltet?
OM: Ich kann nichts dazu sagen, aber die ersten Kriegsmonate liegen lange hinter uns. Die Jungs, mit denen ich angefangen habe, waren im Czernowitzer Territorialverteidigungsbataillon. Unter ihnen waren unter anderem ein Amazon-LKW-Fahrer, jemand, der zuvor Klimaanlagen repariert hatte, sowie Doktoren und Professoren. Sie alle waren an der Räumung Charkiws beteiligt, dann in Bachmut, und jetzt sind sie in der Oblast Sumy, und sie hätten nie gedacht, dass sie ihr Leben der Armee widmen würden. Einige stiegen zu hochrangigen Offizieren auf.
PAP: Können Sie sich vorstellen, jetzt über etwas anderes als den Krieg in der Ukraine zu schreiben?
OM: Russland hat mir unter anderem meine Vorstellungskraft geraubt. Ich kann jetzt keine Romane mehr schreiben. Der Kontext eines umfassenden Krieges, des Einmarsches russischer Streitkräfte, ist ständig präsent, und es ist unmöglich, sich davon zu lösen – er ist mir als Bürger, Schriftsteller und Mensch wichtig. Daher ist mein Spielraum für das Schreiben von Romanen eher begrenzt, aber wenn Sie nach anderen Erfahrungen fragen: Ich lese sehr gerne autobiografische Texte über meine Kindheit. Ich schreibe gerade einen Beitrag für eine Weihnachtsanthologie über die Feiertage in der Ukraine vor der Umstellung vom julianischen auf den gregorianischen Kalender. Die Erinnerung daran, wie ich als Kind mit meinen Eltern gefeiert habe, ist mir sehr wichtig. Vielleicht ist es eine Form der Realitätsflucht für jemanden, der in Erinnerungen lebt, aber auch für einen Autor, der sich erinnert.
PAP: In „Codename für Hiob“ schreiben Sie über Überlebensschuld, die an Berichte aus dem Zweiten Weltkrieg erinnert. Wie gehen Sie mit dem Gefühl um, überlebt zu haben, während andere es nicht geschafft haben?
OM: Ich weiß nicht, wie ich damit leben soll. Die Frage der Überlebensschuld ist Teil eines größeren Kontextes. Die ukrainische Dichterin und Militärangehörige Jaryna Czornohuz beschreibt unseren Zustand mit dem Wort „pisliażytia“ (Lebenszeit). Wörtlich ins Polnische übersetzt, wäre es „zypożyciu“ (Lebenszeit) – zusammengeschrieben. Meiner Meinung nach ist eine Rückkehr in ein früheres Leben unmöglich, denn dieses Leben ist bereits vorbei, und nun geht die „pisliażytia“ weiter. Dazu gehören auch Überlebensschuld und die endlose Anpassung der Zivilisten an immer heftigere Angriffe. Es ist ein Dasein unter Kriegsbedingungen. Man könnte sagen, es ist eine komprimierte Quelle der Emotionen, die manchmal im Alltag ein Ventil findet, sich aber nie ganz entspannen kann. Man wartet ständig auf den nächsten Angriff, darauf, was nach dem Fliegeralarm passieren wird.
PAP: Sie erwähnen auch die Rolle der Post-Erinnerung. Welche Aufgabe sehen Sie in diesem Zusammenhang für die zukünftige Generation?
OM: Einerseits wissen wir, dass Kinder immer gegen ihre Eltern rebellieren, und es besteht die Gefahr, dass sie irgendwann die Realität oder die Erinnerungen, die wir ihnen vermitteln möchten, nicht akzeptieren. Andererseits erleben wir eine wunderbare Generation junger Teenager – wunderbar, stark, im Glauben an eine starke und freie Ukraine. Es ist klar, dass sie sich an ihren Eltern, Angehörigen und Freunden orientieren. Einige von ihnen sind Kinder von Militärangehörigen oder gefallenen Soldaten. Diese Erinnerung und Würde werden sie in die Zukunft tragen.
Ich bin sehr optimistisch, was die Kinder angeht, die während des Krieges geboren wurden. Als Kind unter Kriegsrecht aufzuwachsen, ist absolut grausam und schwer vorstellbar. Gleichzeitig bietet es aber auch eine Grundlage – einen Wegweiser, der es der Ukraine ermöglicht, weiterzubestehen. Das ist entscheidend, denn wir können ihnen vermitteln, wie groß und furchterregend Russland als Phänomen ist und welche immense Bedrohung es für uns alle darstellt. Diese Bedrohung ist nicht nur physischer Natur – sie bedroht unser Leben täglich –, sondern auch metaphysischer Natur. Selbst nach Kriegsende wird Russland nicht verschwinden, und auch sein Hass auf die Nachbarländer wird nicht verschwinden.
Oleksandr Mykhed ist ein ukrainischer Schriftsteller. Er wurde in Nischyn geboren. Er ist Mitglied des ukrainischen PEN-Clubs und Autor von zehn Büchern. Seine Bücher „Ich werde dein Blut mit Kohle vermischen: Den ukrainischen Osten verstehen“ und „Der Codename für Hiob: Chroniken der Invasion“ sind auf Polnisch erschienen. Der Lubliner Verlag Warsztaty Kultury veröffentlichte kürzlich eine Übersetzung seines Buches „Kotek, Kogutek, Szafka“. Es ist auch als Hörbuch erhältlich. Vor der groß angelegten Invasion lebte er vier Jahre lang mit seiner Familie in Hostoml, Oblast Kiew. Ihr Haus wurde in der ersten Kriegswoche von einer russischen Granate zerstört. Er dient derzeit in den ukrainischen Streitkräften.
Gabriela Bogaczyk (PAP)
gab/ dki/
bankier.pl





