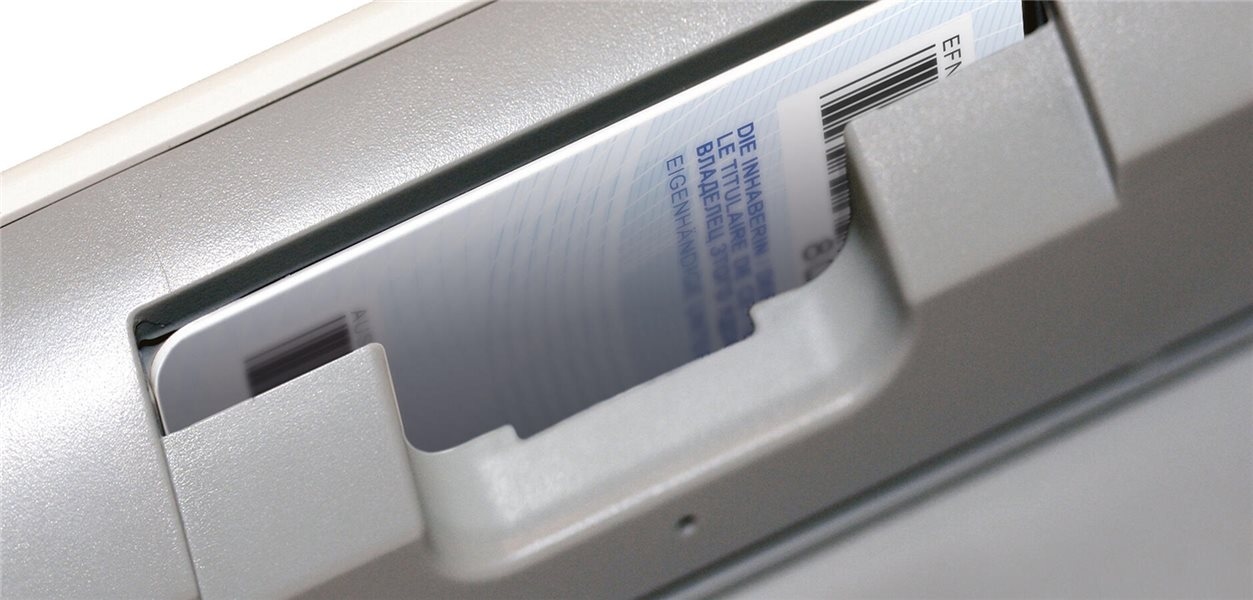Stiko streicht Impfempfehlung für C-Meningokokken

Fast 20 Jahre lang hatte die Stiko empfohlen, Kleinkinder gegen C-Meningokokken zu impfen. Nun wird diese Empfehlung gestrichen, sie gilt als nicht mehr erforderlich. Stattdessen sollen nun Jugendliche gegen vier verschiedene Meningokokkenarten geimpft werden. Der Nutzen der neuen Empfehlung kann nur geschätzt werden. Es fehlen klinische Daten zur Wirksamkeit.
Meningokokken sind Bakterien, die den Nasen-Rachen-Raum von Menschen besiedeln. Das kann in einigen Fällen symptomlos bleiben, in anderen Fällen lösen Infektionen eine Hirnhautentzündung (Meningitis) aus, zusätzlich können sich die Erreger in der Blutbahn ausbreiten (Sepsis). Meningokokkeninfektionen sind zum Glück in Deutschland recht selten. Laut Robert Koch-Institut (RKI) kommen auf 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner 0,4 Erkrankungen pro Jahr (Stand 2024). Und es werden immer weniger. Seit 20 Jahren ist die Zahl der Erkrankungen tendenziell rückläufig.
Allerdings bleiben diese gefährlich: Eine Meningokokken-Meningitis verläuft laut RKI in etwa einem Prozent der Fälle tödlich, eine Sepsis in etwa 13 Prozent der Fälle. Außerdem treten in zehn bis 20 Prozent der Fälle Komplikationen auf, wie Lähmungen oder Krampfanfälle. Spätfolgen können unter anderem ein Hörverlust, Lernschwierigkeiten und eine verminderte Hirnleistung sein. Bei einer Meningokokken-Sepsis müssen in seltenen, schweren Fällen Gliedmaßen amputiert werden.
Ein Großteil dieser Erkrankungen wird dabei durch B-Meningokokken ausgelöst. Eine Impfung gegen B-Meningokokken wird von der Stiko seit 2024 für Säuglinge empfohlen, an ihr hält sie weiterhin fest. Nach Abschluss des ersten Lebensjahres wurde für Kinder bisher aber auch die einmalige Impfung gegen C-Meningokokken empfohlen, was nun nicht mehr gelten soll.

Der Ratgeber für Gesundheit, Wohlbefinden und die ganze Familie - jeden zweiten Donnerstag.DMGOZCVWFNFMJBUMXEZCJBR5CM
Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.
Denn Erkrankungen mit C-Meningokokken, die ohnehin schon selten waren, kommen bei Babys und Kleinkindern in Deutschland praktisch nicht mehr vor. Auch nicht, wenn diese ungeimpft sind. Das ist der Stiko-Begründung zu entnehmen, die dem RND vorliegt. Im Jahr 2024 hatte es demnach keine einzige C-Meningokokkenerkrankung bei ungeimpften Babys gegeben. Bezogen auf alle Altersgruppen gab es 2024 nur 0,01 Fälle pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern.
Nach Einschätzung der Stiko ist die Einzel-Impfung gegen C-Meningokokken nicht mehr notwendig, weil Erkrankungen so extrem selten geworden sind und dies nicht in erster Linie an der Impfung zu liegen scheint. Das erklärte Alexander Dalpke, ärztlicher Direktor des Zentrums für Infektiologie am Universitätsklinikum Heidelberg und Stiko-Mitglied, gegenüber dem Science Media Center (SMC).
Dalpke sagte auch, dass der von der Stiko empfohlene Impfplan für kleine Kinder „sehr dicht“ sei, und entlastet werde, wenn nun eine „nicht mehr notwendige“ Impfung entfalle. Dadurch solle mehr Raum für andere Immunisierungen geschaffen werden. So betonte Dalpke, die Krankheitslast durch Pneumokokken sei 50- bis 100-fach höher als die durch Meningokokken. Die Pneumokokken-Impfung erfolge aber bisher wegen der Meningokokken-Impfung oft zu spät.
„Wir haben tatsächlich einen mittlerweile sehr vollen Impfkalender im ersten Lebensjahr, in den ersten anderthalb Lebensjahren“, sagte Julia Tabatabai bei einem Pressegespräch mit dem SMC. Die Kinder- und Jugendärztin ist Dozentin am Universitätsklinikum Heidelberg und ebenfalls Mitglied der Stiko. Wenn Impfungen, „die eigentlich keine wirkliche Schutzwirkung mehr haben“ wegfallen, könne sich das positiv auf die Durchführung anderer wichtiger Impfungen auswirken, sagte auch Tabatabai.
Allerdings wird zwar der Impfplan für die Kleinsten entlastet – dafür empfiehlt die Stiko nun neu die Kombinationsimpfung gegen Meningokokken A,C,W und Y für Jugendliche im Alter von 12 bis 14 Jahren. Bisher war diese nur für Risikogruppen empfohlen worden: wie Personen mit geschwächtem Immunsystem, Laborpersonal oder bei Reisen in stark betroffene Gebiete. Denn Infektionen mit A-, W- und Y-Meningokokken sind ebenfalls sehr selten.
Auf den ersten Blick erschließt sich die neue Impfempfehlung nicht. Denn die Erkrankungen bei Jugendlichen, denen die Impfung vorbeugen soll, haben nicht etwa zugenommen: Wie auch die Erkrankungen in anderen Altersgruppen nehmen sie seit Jahren tendenziell ab. 2024 kamen auf 100.000 Personen im Alter von 15 bis 19 Jahren nur 0,28 Erkrankungen mit diesen Meningokokkentypen. Es gab damit elf Erkrankungen und nur einen einzigen Todesfall. 2016 hatte es noch 21 Erkrankungen und zwei Tote in dieser Altersgruppe gegeben, also doppelt so viele – aber keine allgemeine Impfempfehlung. Warum also sollen Jugendliche jetzt geimpft werden?
Die Stiko beruft sich auf eine mathematische Modellierung. Ihr zufolge soll sich die Erkrankungslast in der Bevölkerung durch eine Mehrfach-Impfung im Jugendalter am besten senken lassen. Auch, da Jugendliche oft eine besonders starke Erregerlast aufweisen würden und es einen Erkrankungsgipfel im Jugendalter gebe. Dabei war eingeflossen, dass die Stiko eine Verschiebung bei den Serotypen des Virus festgestellt hatte. So würden tendenziell mehr Erkrankungen mit Y-Meningokokken beobachtet, gegen die der Kombinationsimpfstoff wirken soll.
Berechnungen der Stiko zufolge könnten durch die neue Impfempfehlung pro eine Million Jugendlicher zwischen 15 und 19 Jahren etwa drei Erkrankungen verhindert werden. Sie erwarte außerdem eine „leichte“ Reduktion der Fälle in der Bevölkerung insgesamt und dadurch auch einen indirekten Schutz für kleine Kinder. Es müsste also eine sehr große Anzahl an Menschen geimpft werden, um einzelne Erkrankungsfälle zu verhindern.
Zudem kann die Stiko ihre Berechnungen nur auf Schätzungen und Beobachtungen stützen. Bei den verfügbaren Meningokokken-Impfstoffen wurde nicht im Rahmen klinischer Studien untersucht, wie gut und wie lange sie Erkrankungen verhindern können. Stattdessen wurde darin lediglich die Bildung von Antikörpern überprüft: Aus dieser Überprüfung wurde mithilfe einer mathematischen Modellierung eine Wirksamkeit abgeleitet. Es ist also nicht bekannt, wie gut genau und wie lange Meningokokken-Impfungen vor Erkrankungen schützen und wie viele Fälle genau sie pro Jahr verhindern könnten.
Das ist auch ein Grund dafür, warum einige Expertinnen und Experten Meningokokken-Impfungen insgesamt kritisch sehen. So hatte etwa die unabhängige Organisation Ärztinnen und Ärzte für individuelle Impfentscheidungen schon länger kritisiert, dass der Nutzen der Meningokokken-Impfungen wegen fehlender Studien unklar sei. Und zwar nicht nur der Nutzen der jetzt zurückgenommenen Immunisierung gegen C-Meningokokken. Sondern auch der Nutzen der Impfung von Säuglingen gegen B-Meningokokken.
Stiko-Mitglied Alexander Dalpke räumte gegenüber dem SMC ein, dass die Aussagekraft der neuen Modellierungen „tatsächlich nicht besonders hoch“ sei. Weil Meningokokken-Erkrankungen extrem selten seien, gebe es auch nicht viele Studien, die „verlässliche epidemiologische Daten liefern können“. Wegen der „reduzierten Informationslage aus der Literatur“ habe man sich mit einer mathematischen Modellierung beholfen. Es sei wichtig, das Auftreten der Infektionen und der verschiedenen Meningokokken-Typen weiterhin zu überwachen.
Bei einer Impfempfehlung gilt es auch stets, die möglichen Nebenwirkungen gegen den erwarteten Nutzen abzuwägen. Diese ähneln sich bei den in Deutschland zugelassenen Vierfach-Impfstoffen gegen A-,C-,W- und Y -Meningokokken, und zwar Menveo, Nimerix und MenQuadfi. Zu den leichteren und häufiger auftretenden Symptomen gehören Kopfschmerzen, Übelkeit und Fieber. Es wurden laut Packungsbeilagen aber teils auch bedrohlichere Nebenwirkungen beobachtet wie Fieberkrämpfe, schwere allergische Reaktionen oder Ohnmacht. Angaben zur Häufigkeit konnten dabei nicht gemacht werden, da diese erst nach der Markteinführung und nicht in den Hersteller-Studien erfasst worden waren. In der Stiko-Begründung zur neuen Impfempfehlung heißt es, schwere oder schwerwiegende Nebenwirkungen seien „sehr selten“.
rnd